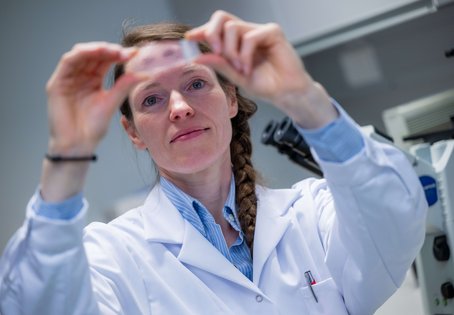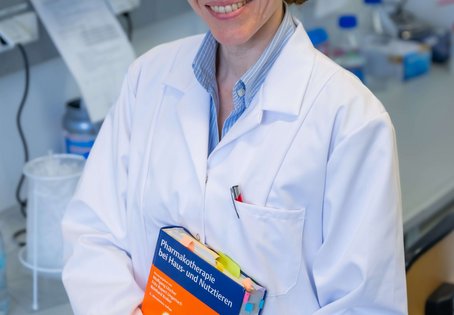- Startseite /
- Universität /
- Infoservice /
- News /
- Impulse aus Labor und Garten – Marion Bankstahl im Porträt
Forschung
Impulse aus Labor und Garten – Marion Bankstahl im Porträt
Intensiv mit Versuchstieren zu forschen und ihnen die beste Haltung und Behandlung bieten zu wollen, ist kein Widerspruch. Marion Bankstahl, neue Leiterin des Fachbereichs Pharmakologie und Toxikologie, forscht zur Vulnerabilität des Gehirns, aber auch zu speziesspezifischem Schmerzempfinden und passenden Analgetika.
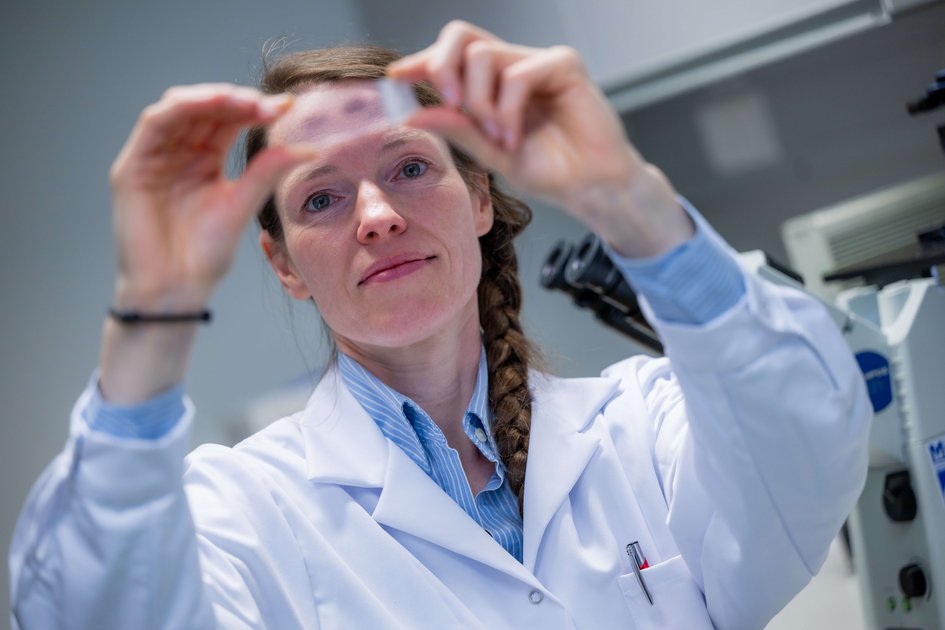
Die Wende kam in der Mitte des Studiums, gerade als Marion Bankstahl an der Tierärztlichen Hochschule Hannover regelmäßig im Notdienst der Kleintierklinik arbeitete. Obwohl die Tätigkeit spannend und herausfordernd war, begann sie über andere tierärztliche Berufsfelder nachzudenken. Bis dahin war alles so klar gewesen: Aufgewachsen in einer kleinen Stadt im ländlichen Nordrhein-Westfalen – mit Kaninchen, Meerschweinchen und aufgepäppelten Vogelküken –, lag der Wunsch nahe, in eigener Praxis Kleintiere zu heilen. Das Reinschnuppern in erste Forschungsprojekte führte zu der Überzeugung, diesen Weg weitergehen zu wollen.
Heute ist Marion Bankstahl Fachtierärztin für Pharmakologie und Toxikologie sowie Fachtierärztin für Versuchstierkunde. Und zwar eine, der das Wohl der „Modellorganismen“ ein echtes Anliegen ist. Als angehende Veterinärin entschied sie sich für Pharmakologie, „weil es ein spannendes Fach mit klinischem Bezug ist“. Für jeden Veterinär und jede Veterinärin gehört es zum Rüstzeug: von der Prophylaxe und der zu einer Diagnose passenden wirksamen und verträglichen Therapie bis hin zur besten Strategie in Hinblick auf Lebensmittelsicherheit (One Health).
Eine Schranke als Startlinie
Die Startlinie für ihre fachliche Spezialisierung war eine Hürde – die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. So wird die zelluläre Grenze zwischen Blut und Zentralnervensystem genannt. Die Gefäßwand lässt nur bestimmte Stoffe ins Gehirn übertreten und schützt es so vor schädlichen Stoffen, Krankheitserregern und Giften. Hingegen wird der Energielieferant Glukose durch bestimmte Kanäle vermehrt in die Denkzentrale gepumpt. Die Blut-Hirn-Schranke sorgt für ein ausbalanciertes Milieu im Gehirn, versorgt es mit Nährstoffen und transportiert Stoffwechselprodukte wieder ab. Ihre Doktormutter an der Ludwig-Maximilians-Universität München gab Marion Bankstahl den entscheidenden Drall mit dem Forschungsthema „Pharmakoresistenz bei Epilepsiepatient:innen“.
Denn auch Katzen und Hunde leiden an den unvorhersehbaren Anfällen, die je nach betroffener Gehirnregion, Schwere oder Häufigkeit weitere Schäden nach sich ziehen können. Obwohl es wirksame Medikamente gibt, verhindert ein natürlich vorkommender Abwehrmechanismus der Blut-Hirn-Schranke nicht selten, dass der gewünschte Wirkstofflevel erreicht wird. Ausgehend von ihrer Dissertation fand sie immer weitere Anknüpfungspunkte für translationale Forschungsthemen und den zeitgemäßen Umgang mit Labortieren.
An der Vetmeduni möchte sie weiter zur Vulnerabilität des Gehirns forschen und wie man nach Hirnschäden sinnvoll medikamentös eingreifen kann. Was im Gehirn von Katze oder Mensch passiert, nachdem es durch eine Infektion oder ein Schädel-Hirn-Trauma vorgeschädigt wurde, lässt sich bei Nagetieren als Modellorganismen ganz gut nachstellen. Zeitlich gestaffelt und komplex verkettet werden mehrere Schadprozesse losgetreten. Die langfristige Vision der Pharmakologin sind translationale Therapiestrategien und passende Wirkstoffcocktails (Multitarget), die je nach Vorfall und Vorschädigung eine voranschreitende Hirnschädigung hintanhalten. Zudem interessiert sie sich dafür, wie sich die Anreicherung von Nanoplastik im Gehirn langfristig auswirkt. Ihre Pionierarbeit zu speziesspezifischer Schmerztherapie für kleine und große Labortiere sowie Indikatoren zum Schmerzempfinden will sie vorantreiben, um Tierleid in notwendigen Versuchsreihen zu minimieren. Mit ihrer Forschungsgruppe hat sie angepackt und Drittmittel eingeworben, um fehlende Daten zu beschaffen. Es geht um Analgetika auch für Mäuse und Ratten sowie an ihre Besonderheiten angepasste Schmerztherapie-Protokolle.
An der Vetmeduni freut sie sich auf die Gestaltungsmöglichkeiten, die ihre Professur für Pharmakologie und Toxikologie mit sich bringt. Seit Langem wird dieser Fachbereich wieder in der Hand einer Veterinärin liegen. Ein weiteres Plus für die Fachtierärztin ist die erneute enge Zusammenarbeit mit Tierärzt:innen. In den vergangenen Jahren fehlte dieses Umfeld ein wenig, leitete Bankstahl doch zuletzt die Abteilung Experimentelle Anästhesie, Analgesie und perioperative Betreuung für Labortiere am Institut für Versuchstierkunde und der Zentralen Tierhaltung der Medizinischen Hochschule Hannover.
Ein großer Umzug
Gerade pendelt sie noch zwischen Wien und Hannover, betreut ihre Post-Doktorandin im laufenden DFG-Projekt, rekrutiert wissenschaftliches Personal für ihre Wiener Forschungsgruppe, bereitet mit Systematic Reviews Drittmittelanträge vor, beschafft fehlende Laborausstattung für In-vivo-Versuche, kümmert sich um eine Tierversuchsgenehmigung und um spezielle Haltungssysteme für ihre Versuchstiere, die ihren Ansprüchen genügen. Mit Möglichkeiten zum Nestbau, zum Buddeln, zur Kommunikation zwischen den Gruppen, damit sie wenig Stress haben. Anfang 2025 will sie startklar sein.
Mittelfristig werden auch ihr Mann und ihre drei Kinder Wien zum Lebensmittelpunkt machen. Zudem auch eine Handvoll Schafe und ihr Jagdhund. Sie will den selbst gebauten mobilen Hühnerstall wieder aufstellen und Bienenvölker betreuen. Im Garten zu arbeiten war immer ein Ausgleich zur Laborarbeit und Ausdruck einer „speziesübergreifenden“ Tierliebe: „Bei der Arbeit mit den Bienen muss ich fokussieren, sonst kassiere ich sofort einen Stich. Die Interaktion mit den Tieren macht mir Spaß und ich möchte meinen Kindern einen wertschätzenden Umgang mit Natur und Umwelt vorleben. Zudem bekomme ich immer wieder Impulse für Forschung und Lehre.“ Die honigliefernden Bienen etwa sind ein gutes Beispiel dafür, dass Pharmakotherapie und Lebensmittelsicherheit zusammenhängen. Gerade Schafe und Ziegen galten lange Zeit in puncto Schmerzen als robust, weshalb es noch große Wissenslücken gibt.
Marion Bankstahl arbeitet interdisziplinär und hat Forschungskontakte zur MedUni Wien und zum AKH geknüpft, als sie mit Positronen-Emissions-Tomografie (PET) begann, um nichtinvasiv ins Gehirn hineinzuschauen: „Meine Forschung kann ich hier gut weiterführen und sie wird noch bereichert. One Health wird eine immer noch größere Bedeutung erlangen und der Forschungsbedarf ist riesig.“ Die Studierenden will sie in Pharmakologie und Toxikologie gut auf die berufliche Tätigkeit vorbereiten, damit sie sicher und zielführend am Patienten arbeiten können. In den Übungen streicht sie deshalb bewusst praktische Bezüge des Lehrstoffs heraus. Den einen oder die andere wird sie dabei sicher für die Forschung gewinnen können.
alle Fotos: Michael Bernkopf/Vetmeduni
Text: Astrid Kuffner
Der Beitrag ist in VETMED 03/2024 erschienen.