- Startseite /
- Universität /
- Infoservice /
- Presseinformationen /
- Immunregulatoren mit Achillesferse – Katarzyna Sitnik im Portrait
Forschung
Immunregulatoren mit Achillesferse – Katarzyna Sitnik im Portrait
Indem die im Bindegewebe lymphatischer Organe sitzenden Stromazellen mit Immunzellen interagieren, beeinflussen sie die Immunabwehr. Doch wie laufen diese Prozesse genau ab? Katarzyna Sitnik, Assistenzprofessorin für Virologie und die Mechanismen und Dynamik viraler Infektionen, ist noch unbekannten Aspekten der Stromazellbiologie auf der Spur.
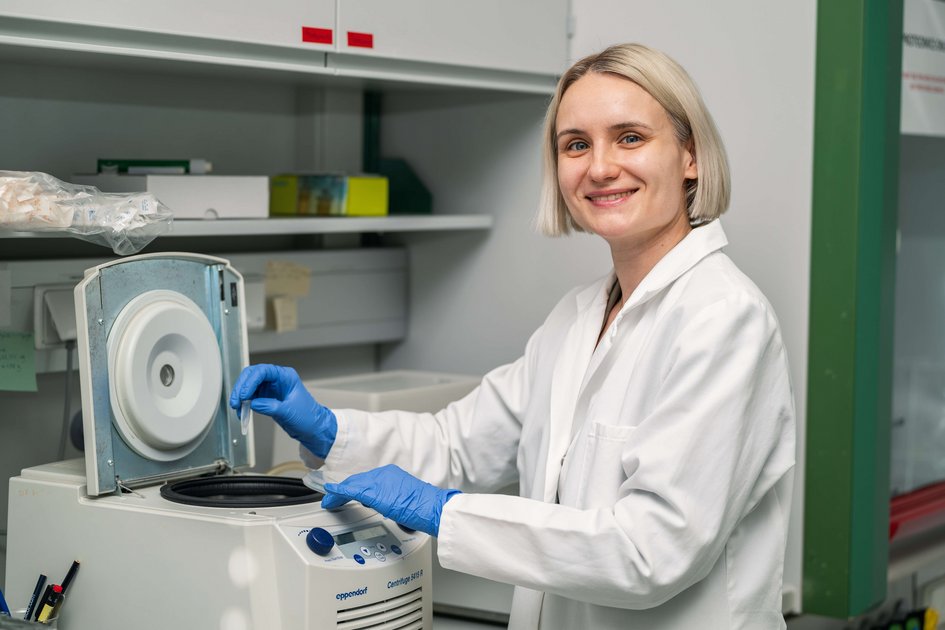
Ihre Leidenschaft für die Immunologie hat Katarzyna Sitnik während ihres Biotechnologiestudiums in Krakau entdeckt. „Dass das Immunsystem so unfassbar kompliziert ist, hat wohl meine Wettkampfmentalität angesprochen“, resümiert die ehemalige Leistungssportlerin mit einem Lächeln. „Herausforderungen stacheln mich an.“ Ihre frühen Teenagerjahre, in denen sie in ihrer Heimat Polen an nationalen Meisterschaften im Wasserspringen teilnahm, zeugen davon. Darüber hinaus begeisterte sie sich schon damals für Biologie. „Vor allem offene Fragen haben mich gereizt“, erzählt sie. „Ich wollte immer mehr erfahren, als in den Schulbüchern stand.“ Tatsächlich hat sie aus ihrer Schulzeit vieles mitgenommen, das ihr heute als Forscherin nützt: Ihr sportlicher Ehrgeiz und ihr Wissensdrang ließen sie Disziplin, Ausdauer und Resilienz entwickeln. Die Bronzemedaille bei einer internationalen Biologieolympiade brachte ihr zudem einen Freiplatz – ohne Aufnahmeprüfung – in einem selbstgewählten biologieorientierten Masterstudienprogramm ein.
Nicht nur Stützfunktion
Ihr Forschungsfokus sind die bislang noch wenig beachteten Stromazellen. „Stroma“ bedeutet auf Altgriechisch Schicht oder auch Bett und bezeichnet das stützende Bindegewebe eines Organs. Die ersten Schritte auf diesem Feld machte sie an der Universität Lund in Schweden, wo sie in Immunologie promovierte. „Es ist mittlerweile bekannt, dass Stromazellen lymphatischer Organe nicht nur ein strukturelles Element sind, sondern auch wichtige Regulatoren des Immunsystems. Sie kommunizieren mit den Immunzellen und orchestrieren Prozesse zwischen ihnen, die für eine koordinierte Immunantwort notwendig sind.“ Zur Klärung, wie sie das machen, habe man allerdings erst an der Oberfläche gekratzt.
Als Doktorandin hat Katarzyna Sitnik untersucht, wie Stromazellen sich im T-Zell-produzierenden Organ, dem Thymus, gegenseitig regulieren und wie sie die T-Zell-Entwicklung durch einen von Vitamin A gesteuerten Signalweg beeinflussen. T-Zellen sind weiße Blutkörperchen, von denen manche körperfremde Strukturen erkennen und bekämpfen und andere, die T-regulatorischen Zellen, Kontrollposten gegen überschießende Immunreaktionen sind. In ihrer Postdoc-Zeit – zuerst in Dänemark, dann am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig – befasste sie sich damit, wie sich Stromazellen in den Lymphknoten und in der Milz für bestimmte Aufgaben spezialisieren. „In verschiedenen Ländern jeweils einem anderen Aspekt nachzugehen, hat mir viel gebracht. Die Summe all dieser Erfahrungen ist meine Expertise.“ Diese bringt sie nun am Zentrum für Pathobiologie der Vetmeduni ein, wo sie eine Forschungsgruppe leitet und seit Mai Assistenzprofessorin für Virologie und die Mechanismen und Dynamik viraler Infektionen ist. „Ich habe hier ein tolles und hochkarätiges kollegiales Umfeld“, freut sie sich. „Außerdem finde ich, dass die Stadt Wien ihren Toppositionen in internationalen Lebensqualitätsrankings absolut gerecht wird.“
Viren-Unterschlupf im Bindegewebe
Gerade steckt sie mitten in einem FWF-Projekt, das die Interaktion der Stromazellen mit den Antikörper produzierenden B-Lymphozyten beleuchtet. Sie beschäftigt sich aber nicht nur mit der immunmodulierenden Rolle der Stromazellen, sondern auch mit deren Achillesferse: „In manchen Stromazellender lymphoiden Organe können Viren das Immunsystem austricksen und sich dort einnisten und aufrechterhalten.“ Herpes- oder HI-Viren zum Beispiel schlummern hier lange, ohne dass der Körper sie eliminieren kann. Wie die dafür verantwortlichen molekularen Mechanismen zwischen den Viren und Stromazellen genau aussehen, möchte sie herausfinden. „Unsere spannenden vorläufigen Ergebnisse geben uns eine Vorstellung davon, in welche Richtung es gehen könnte.“ Ihre Studierenden möchte Katarzyna Sitnik von Beginn an zur Selbstständigkeit ermutigen. „Mir macht es Freude zu sehen, wie ihr wissenschaftliches Urteilsvermögen durch den Erwerb von Wissen und Erfahrung wächst und sie selbst Dinge entdecken.“ Dies gelinge nur durch Tun und Machen. Freilich motiviere allein schon die Attraktivität des Arbeitsfelds dazu, ist sie überzeugt. Was vermutlich der Grund dafür ist, dass sie auf die Frage nach ihrem privaten Ausgleich lachend antwortet, die Wissenschaft sei nicht nur ihr Beruf, sondern fast auch ihr größtes Hobby.
alle Fotos: Michael Bernkopf/Vetmeduni
Text: Uschi Sorz
Der Beitrag ist in VETMED 03/2024 erschienen.








