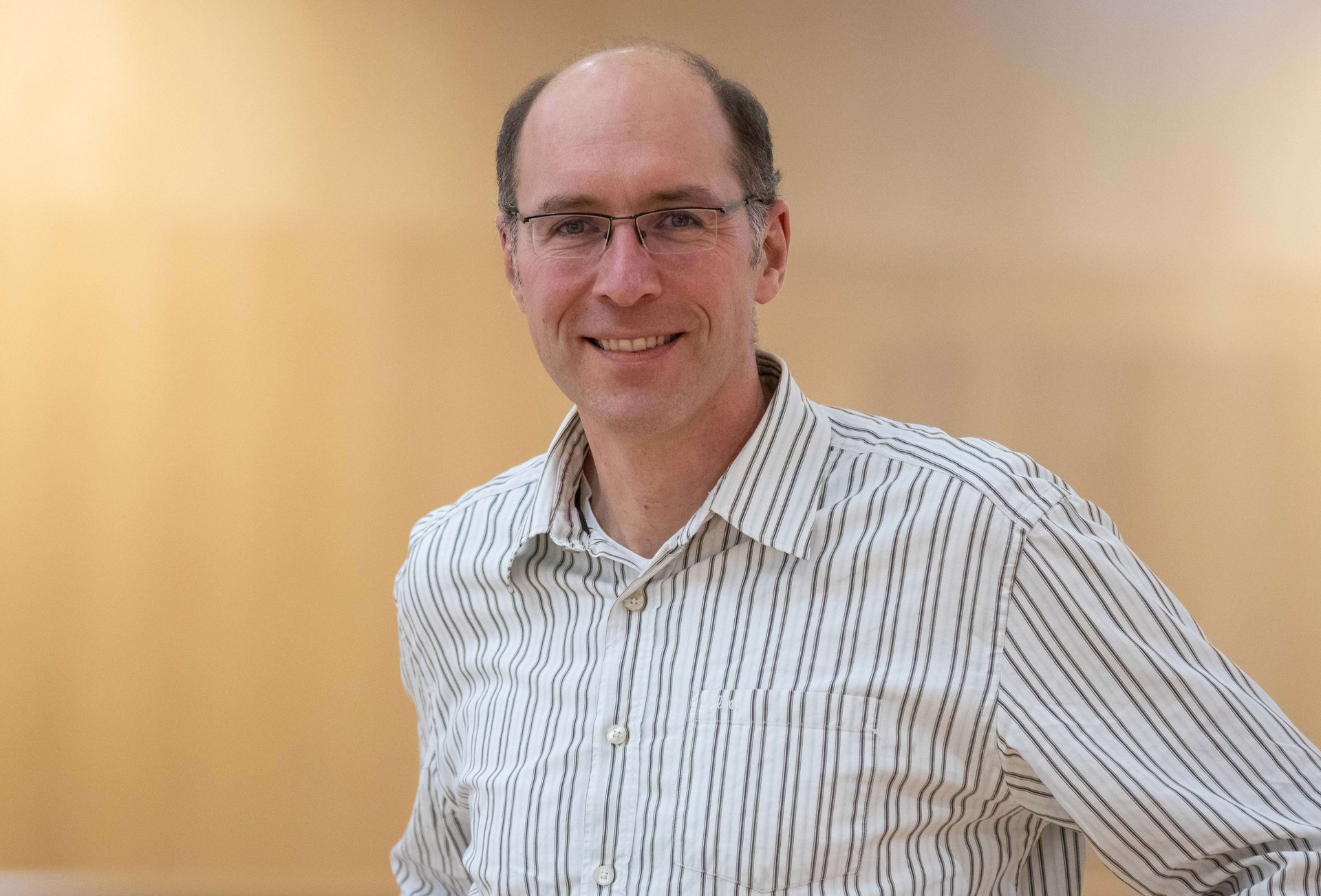- Alumni-Porträts /
- Archiv
Archiv Karrierewege – Absolvent:innen im Porträt
VETMED: Vor eineinhalb Jahren haben Sie Ihr Beratungsunternehmen www.schweinekompetenz.at gegründet. Die Domain ist eine starke Ansage, wie kam es dazu?
Werner Hagmüller: Meine Beratungstätigkeit rund um Schweinehaltung, Stallbau, Fütterung und Management hat sich über viele Jahre entwickelt, da muss ich weiter ausholen. Ich bin in einem Milchviehbetrieb großgeworden und habe die HLBLA St. Florian absolviert. Mein Berufsziel war ursprünglich Großtierpraktiker für Rinder. Ich habe Veterinärmedizin studiert mit dem Wunsch in einem Fachgebiet richtig gut zu werden. Nach dem Abschluss hatte ich das Gefühl, sehr viel im Überblick, aber immer noch relativ wenig vertieft zu wissen. Das war ein bisserl frustrierend. Ich habe dann am Institut für biologische Landwirtschaft der HBLFA Raumberg Gumpenstein begonnen, zehn Jahre bei einem Kollegen in einer Großtierpraxis gearbeitet und meine Dissertation verfasst.
VETMED: Wie kam es dazu? Das klingt nach einem Umweg, um sich auf Schweine zu spezialisieren.
Hagmüller: Tatsächlich war ein Zufall ausschlaggebend für den weiteren Weg. Der Leiter des Instituts hat mich im Auto zu einem Rinderbesamungskurs mitgenommen und mir im Gespräch eine Teilzeitstelle am Institut und eine Doktorarbeit angeboten. Ich habe mich dann an der HBLFA viele Jahre wissenschaftlich mit biologischer Landwirtschaft beschäftigt, mich also hier intensiv weitergebildet und den Fachbereich alternative Schweinehaltung am Standort Wels etabliert. Als Tierarzt betrachte ich Tiergesundheit gesamthaft. Herkunft, Haltung, Stallbau, Fütterung, Management und viele weitere Faktoren wirken sich darauf aus. Aus dem spontanen Angebot wurden letztlich 25 Jahre, in denen ich ab 2014 das Institut geleitet habe.
VETMED: Was ist dann passiert?
Hagmüller: Ich bin 50 geworden. Da kaufen sich andere ein Motorradl. Ich habe 2023 aus meinem Arbeitsplatz im Bundesdienst in die Selbständigkeit gewechselt. Wir haben viele Jahre interessante und breitenwirksame Projekte zur Bioschweinehaltung abgeliefert, aber irgendwann geht dir der Schmäh aus. Ich hatte das Gefühl keine neuen Ideen mehr liefern zu können. Ich habe einen Cut gebraucht. Obwohl ich als Chef viel Gestaltungsfreiheit hatte, wollte ich nicht mehr 40 Stunden angestellt sein und in die Arbeit fahren. Zu Hause hatte ich nebenbei schon meinen kleinen Betrieb mit Freiland-Mastschweinen und Direktvermarktung, in dem ich vor und nach der Arbeit zu tun hatte.
VETMED: Und arbeiten Sie jetzt weniger?
Hagmüller: Es geht wohl eher um die Zeitautonomie. Ich bin happy, weil ich jetzt 100% fachlich arbeite, muss weder Anträge noch Berichte verfassen, habe keine Projektvorgaben und keine Abstimmungen. Der Pferdefuß ist, dass sich selbst für mein Einkommen sorgen muss. Aber ich war auch nicht mehr im Aufbau: das Haus ist abbezahlt, unsere 4 Kinder zum Teil schon aus dem Haus und meine Frau führt eine Kleintierordination – ich muss(te) niemandem mehr etwas beweisen.
VETMED: Aber wie sind Sie genau vom Rind aufs Schwein gekommen?
Hagmüller: Bis zur Dissertation war ich voll auf dem Rindertrip. Für den Sohn eines Milchviehbauern ist das Schwein erst einmal ein Tier zweiter Klasse, uninteressant und es stinkt. Dann habe ich einen Vortrag von Martina Jugl-Chizzola zum Thema Phytotherapie bei Schweinen gehört. Mir wurde klar, dass wir über alternative Haltungsformen zuwenig wissen, weil die meisten Schweine in Massentierhaltung leben. Wir haben am Institut in Wels einen Rinder- auf einen Schweinestall umgebaut, parallel habe ich in Oftering meinen Betrieb mit Wiesenschweinen aufgebaut. Im Studium gab es damals noch keine Spezialisierung also war da viel learning by doing. Es war für mich ganz gut nicht zu vorgeprägt zu sein, sondern neugierig auf das neue Tier, um es besser kennenzulernen. Schweine lassen sich im Verhalten sehr gut über den Stallbau lenken, weil sie so intelligent sind. Meinen Schwerpunkt habe ich also viele Jahre aufgebaut. Niemals hätte ich zu Beginn des Studiums gedacht, dass ich mal Vorträge halte oder wissenschaftlich tätig bin. An der HBLFA habe ich zu Herausforderungen immer ja gesagt. Das hat mir rückblickend eine Entwicklung ermöglicht, die sich nicht ergeben hätte, wenn es nur an mir gelegen wäre.
VETMED: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag heute aus?
Hagmüller: Es gibt keinen, das begeistert mich. Ich habe eine tierärztliche Zulassung ohne Hausapotheke, stehe also nicht in Konkurrenz zum Tiergesundheitsdienst oder den Praktikern mit Hausapotheke. Wenn in der Region akut kein Großtierarzt erreichbar ist, rufen sie meine Frau an, bei der ich in der Ordination geringfügig angestellt bin. Dann helfe ich, weil ich es ja kann und es meine Verpflichtung ist. Aber Akutfälle mache ich ganz selten – ich bin Berater für landwirtschaftliche Betriebe zu den Themen Fütterung Management, Stallbau und Haltung immer aus der Perspektive Tiergesundheit. Von mir angeregte Veränderungen müssen nicht sofort erfolgen, sondern sollen den Tierbestand letztlich gesünder machen. Ich werde angerufen, wenn formal alles richtig gemacht wird und dennoch Probleme auftauchen oder ein Experte für Schweine angefragt wird.
VETMED: Wer ist Ihre Zielgruppe – die Bioschwein-Landwirt:innen oder konventionelle Landwirt:innen, die etwas ändern wollen?
Hagmüller: Bei den Bioschweinehalter:innen bin ich von meiner Forschungstätigkeit bekannt und biete ein Sorgentelefon an, wobei diese Beratung dann über Bioschwein Austria abgerechnet werden kann. Tierwohl wird immer mehr zum Thema und die meisten meiner Kund:innen haben eine konventionelle Haltung und wollen jetzt einen Schritt machen: mehr Platz schaffen, einen Auslauf, eine zweite Klimazone – sie wollen aus dem Eck heraus, in das sie von der Gesellschaft gedrängt werden. Es ist einfacher, wenn junge Leute von ihren Eltern den Betrieb übernehmen und sowieso investieren müssen. Da kann ich meistens wirklich gut helfen, wobei es nicht immer ein Neubau werden muss, auch im Bestand lässt sich viel machen. In einem relativ frisch hochkonventionell ausgerüsteten Betrieb, ist es schwieriger – da liefere ich realistische Einschätzungen.
VETMED: Das Hausschwein ist laufend von vielen Krankheiten bedroht. Kann man da mit ihren Konzepten etwas bewirken?
Hagmüller: Wenn es um Stallbau geht, ist Biosicherheit ein wichtiger Teil – die Öffnung bedeutet immer auch Risiko. Ich mache immer ganz klar, dass den eigenen Tierbestand vor Infekten zu schützen, das Wichtigste ist. Als Teil der Biosicherheitskommission im Gesundheitsministerium kenne ich die Vorgaben gut.
VETMED: Sind Sie jetzt so spezialisiert, wie Sie das immer sein wollten?
Hagmüller: Meine Nische ist Tiergesundheit beim Schwein– in der Beratung von Einzelbetrieben – hier fühle ich mich als Spezialist. Ich möchte aber allen Kolleg:innen mitgeben, dass Veterinär:innen die umfassendste Ausbildung für so ein vernetztes Denken haben. Wir kennen die Zusammenhänge der Einflussfaktoren und die Konsequenzen auf die Tiergesundheit. Da dürfen wir uns auch zutrauen, wieder mehr Aspekte der Tiergesundheit zu betrachten und nicht nur Diagnostik und Therapie anzubieten.
Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.
VETMED: Wollten Sie immer Tierärztin werden? Oder war auch Berufsmusikerin eine Option? Sie haben ja am Konservatorium in Wien und Vorarlberg Bratsche studiert und in Orchestern mitgewirkt.
Annette Nigsch: Ich war tatsächlich lange gespalten, ob ich Musikerin oder Tierärztin werden möchte. Es ist einfach so: Ich kann Tierärztin sein und daneben viel und gut Musik machen, aber nicht umgekehrt. Ich bin in einem steilen, abgeschiedenen Seitental in Vorarlberg aufgewachsen, auf einem sehr kleinen Bergbauernhof mit Kühen. Dort passiert viel in Handarbeit und ich war als Kind in diese Tätigkeiten eingebunden. Wenn der Großtierpraktiker vorbeikam, war das wichtig und interessanter Besuch und hat mein Berufsbild geprägt. Musik hat man in der lokalen Kapelle gemacht.
VETMED: Sie waren die Erste in der Familie, die studiert hat. Wie sind Sie zurechtgekommen?
Nigsch: Es war gut für mich, als 19-Jährige diesen Schritt alleine zu machen – vom Bergdorf mitten in die Wiener Großstadt einzutauchen. Ich habe als Musikerin nebenbei Geld verdient und aufgrund meiner Herkunft die höchste Studienbeihilfe bekommen.
VETMED: Wie kam es nach dem Start zu Ihrer Spezialisierung?
Nigsch: Mein Ziel war Großtierpraktikerin zu werden. Dass es so etwas wie ein öffentliches Veterinärwesen gibt, war mir zu Studienbeginn nicht bekannt. Die Augen dafür geöffnet hat mir ein Wahlfach bei Hermann Unger zu „Epidemiology of Emerging Diseases“. In einem Artikel stand, dass es mehr Menschen braucht, die zwischen Tiergesundheit, Labor und Interventionen zum Schutz der Gesundheit der Menschen eine Brücke schlagen. Da wusste ich, dass ich genau das machen will Es gab nicht viele Studierende mit Interesse an Veterinary Public Health – daher auch Förderung von Seiten der Arbeitgeber. In meinem Jahrgang haben wir den Verein „Public Health Pool“ gegründet, um mehr Studierende dafür zu interessieren. Inzwischen ist diese Initiative eingeschlafen, aber wir haben einige Leute überzeugt.
VETMED: Sie haben 2009 bis 2012 ein Residency Programm des European College of Veterinary Public Health (ECVPH) absolviert. Wieso war das wichtig?
Nigsch: Das war eine ganz neue Welt im Vergleich zur Uni, wo in meinem Curriculum das Pflichtfach Veterinärwesen eine der letzten Mini-Prüfung war. Ich muss Tierärztin sein, um meinen Job auszuüben und habe im Studium wichtige Grundlagen gelernt. Für die Ausbildung zum Diplomate bin ich ans Royal Veterinary College in London gegangen und konnte mich drei Jahre in meinen Fachbereich intensiv weiterbilden. Epidemiologie und Statistik waren wichtig, Risk-Assessment, aber auch wie die Gesetze und internationalen Regeln im Bereich Tiergesundheit funktionieren.
VETMED: Sie haben von der Landesveterinärdirektion in Bregenz nach London gewechselt – ein ziemlicher Sprung.
Nigsch: Glauben Sie mir, in diese Richtung ist es leichter, als umgekehrt (lacht). Ich hatte das große Glück, dass mir meine Betreuerin freie Hand gelassen hat. In meiner Residency habe ich mir mein Programm selbst zusammengestellt und mich im Netzwerk beworben. So war ich u.a. in der Europäischen Kommission in Brüssel, bei der WHO in Kopenhagen, bei Defra in London oder SAFOSO in Bern. Man muss die Institutionen und ihre Möglichkeiten gut kennen, die Ebenen im Zusammenhang sehen, um an den richtigen Strängen ziehen zu können. Jede Erfahrung in diesem Bereich zählt. Heute bin ich selbst im Education Committee des ECVPH und lese die Lebensläufe vieler toller Menschen.
VETMED: Sie haben beruflich immer wieder den Ort gewechselt...
Nigsch: Stimmt! Anfang 2024 bin ich zum 25. Mal umgezogen. Das beherrsche ich inzwischen sehr gut. Den Traum vom Eigenheim mit Garten und Haustieren habe ich erst einmal aufgegeben. Mein Leben passt in eine Tasche mit Laptop, Zahnbürste und Visitenkarten.
VETMED: Wie sieht Ihr beruflicher Alltag bei der AGES jetzt aus? Sie sind seit Anfang 2024 Leiterin des Instituts für veterinärmedizinische Untersuchungen in Innsbruck im Geschäftsfeld Tiergesundheit?
Nigsch: Am IVET Innsbruck steht die Infektionsdiagnostik der kleinen Wiederkäuer im Fokus. Zudem sind an diesem Standort das Pathologiezentrum West, das Nationale Referenzlabor für Parasiten und Trichinen sowie das Kompetenzzentrum für alpine Wildtierkrankheiten angesiedelt. Es gibt enge Kooperationen mit praktischen und amtlichen Veterinär:innen, den Tiergesundheitsdiensten, der Jägerschaft und Tierhalter:innen. Innsbruck ist neben Mödling und Linz einer von drei IVET-Standorten der AGES, zuständig für die Überwachung von Tierseuchen in Österreich. Wir übernehmen aus Westösterreich zehntausende Proben von Nutz- und Wildtieren jährlich, ein ziemlich breites Spektrum, aber für uns Routine. Meine Mitarbeiter:innen sind in der wichtigen Labordiagnostik, mein mittelfristiges Ziel ist, zusätzlich eine Epidemiologiegruppe aufzubauen, um den Mehrwert aus den Labordaten weiter zu steigern.
VETMED: Sie beschäftigen sich mit Infektionsdynamik und Früherkennung – was klappt gut und wo gibt es Lücken?
Nigsch: Sehr viele Abläufe sind ab dem Zeitpunkt des Seuchen-Verdachtsfalls durch Gesetze geregelt. Ausbaufähig ist meines Erachtens die Früherkennung, die letztlich von der disease awareness draußen in den Ställen abhängt. Das ist vor allem eine Frage der Kommunikation. Was bei einem Wildtier auftritt, kann ein Nutztierthema werden, und beim Menschen ein echtes Problem. Da müssen wir schneller und durchlässiger werden. Corona hat das Thema One-Health hoch auf die Agenda gesetzt. Ein praktisches Beispiel für die Umsetzung wäre: Weiß ein Hausarzt, dass in seinem Bezirk Tularämie/Hasenpest bei Hasen oder Zecken nachgewiesen wurde, denkt er bei einem Patienten mit geschwollenen Lymphknoten differentialdiagnostisch auch daran. Wenn umgekehrt eine Person die Diagnose Tularämie bekommt, müssen wir reagieren und uns fragen, wo sie sich angesteckt hat, um weitere Fälle zu verhindern.
VETMED: Sie waren fünf Jahre selbständige Beraterin. Jetzt arbeiten Sie in einer behördennahen Agentur – worin liegt für Sie der Reiz?
Nigsch: Die Entscheidung habe ich getroffen, weil ich meine Arbeit als Expertin auf den Boden bekommen möchte – dafür ist die AGES der richtige Platz. Wir müssen uns zukünftig intensiver mit Wildtieren und Vektoren beschäftigen und brauchen Kolleg:innen, die sich sektorübergreifend bei Themen der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt auskennen. Deshalb unterrichte ich auch am FIWI. In der AGES baue ich neben meinen Führungsaufgaben gemeinsam mit Kolleg:innen aus verschiedenen Institutionen, auch der Vetmeduni, die One-Health-Überwachung aus. Dazu laufen ein nationales Stechmücken- und Zecken-Monitoring sowie die gezielte Überwachung von Vogel- und Schweine-Influenzaviren, die von der WHO, ECDC und EFSA als prioritär eingestuft wurden.
Alarmbereitschaft als tägliches Arbeitsumfeld: Wie gehen Sie damit um?
Nigsch: Als ich im Jänner begonnen habe, habe ich alle Mitarbeiter:innen zum Kennenlerngespräch gebeten. So wie ich arbeiten hier ganz viele „because it matters“. Permanente Alarmbereitschaft gehört dazu. Man kann es auch so sehen: Da ist Energie dahinter und die tut gut.
Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.
VETMED: Wollten Sie immer Tierarzt werden?
Martin Appelt: Ich hatte immer und habe noch mehrere Interessen: die Feuerwehr, einige Zeit war ich stark beim Bundesheer involviert und die veterinärmedizinische Expertise bei der Seuchenbekämpfung. Bei genauerem Hinsehen haben sie Gemeinsamkeiten: die Idee des Helfens oder auch regelmäßig mit einer überraschenden Situation konfrontiert zu sein, die man analysieren und lösen muss. Das spiegelt schon meine Neigungen wider. Ich war immer interessiert an Tierhaltung, weil ich die Sommer oft bei der Verwandtschaft mit Nutztieren verbracht habe. Als ich abgerüstet habe, war meine neue Vollzeitbeschäftigung das Studium. Daneben habe ich immer etwas gearbeitet, z.B. habe ich in Wien Falschparker abgeschleppt.
VETMED: Wie kam es zum Wechsel nach Kanada? War das schon lange Ihr Traumland?
Appelt: Mich hat die Liebe nach Kanada geführt. Wie das Leben so spielt. Ich war nach dem Diplom in einer landwirtschaftlichen Nutztierpraxis tätig, wollte aber ein Doktorat machen, also habe ich mir einen passenden Job für meine Spezialisierung auf Tierschutz und Tiertransport gesucht. Ich war zum Zeitpunkt der laufenden Beitrittsverhandlungen an der tschechischen Grenze als Amtstierarzt im Einsatz, damals eine EU-Außengrenze. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis es meinen Job nicht mehr geben würde. Ich hatte durch die Tätigkeit beim Heer und in der Seuchenbekämpfung einiges über „One Health“ gelernt und wollte in dieser Sparte weitermachen. Es ist vielleicht ein Persönlichkeitsmerkmal: Ich habe eine Abneigung gegen Positionen, wo ich mich eingesperrt fühle, ohne Möglichkeit für Aufstieg und Weiterentwicklung. 2001 fiel also meine Entscheidung mit nach Kanada zu gehen.
VETMED: Kanada ist bekannt dafür, qualifizierte Arbeitskräfte bevorzugt als Staatsbürger:innen anzuheuern. Lief alles glatt?
Appelt: Einwanderung als qualifizierte Arbeitskraft ist im nationalen Interesse, aber bei hoch reglementierten Berufen wie Veterinär- oder Humanmediziner:in, steuern die Berufskammern mit. Sie setzen Standards für die Profession, um die Qualität sicherzustellen und begrenzen dadurch den Zuzug. Ich habe fünf Jahre für die kanadische Lizenz gebraucht, um in meinen Beruf zurückzukehren. Das war viel Lernaufwand und eine große finanzielle Hürde.
VETMED: In einer Bundesbehörde, der Canadian Food Inspection Agency CFIA, haben Sie hingegen sofort Fuß gefasst. Eine beachtliche Leistung für einen „Zugroasten“?
Appelt: Ich hatte einen Kontakt in die CFIA bevor ich nach Kanada gegangen bin. Mir war klar, dass ich mich nicht sofort als Tierarzt würde niederlassen können. Das Doktorat in Tierschutz und Tiertransport war entscheidend, um als Spezialist angeworben zu werden. Die Bundesveterinärbehörde kümmert sich um Tiergesundheit, Pflanzenschutz und Lebensmittelsicherheit. In den vergangenen 20 Jahren habe ich mich vom technischen Spezialisten zum Senior Executive hinaufgearbeitet. Von den 250.000 Mitarbeiter:innen im Kanadischen Bundesdienst sind nur 2 % Executives. Da kann ich also durchaus stolz sein.
VETMED: Was umfasst Ihr Aufgabengebiet als Senior Director im Animal Health Program?
Appelt: Ich habe ein Team von 45 Veterinär:innen und wissenschaftlichen Spezialist:innen, die sämtliche Protokolle für die Tierseuchenbekämpfung entwickeln. Es geht um das gesamte Spektrum von Krankheiten, die man nicht einschleppen möchte, bis zu denen, die da sind und die man managen muss. Für die Einfuhrkontrollen arbeiten wir mit anderen Einheiten wie Zoll oder Polizei zusammen. Wir machen Notfallpläne und exekutieren diese, wenn erforderlich. Eine mittelbare Bundeverwaltung wie in Österreich, gibt es in Kanada so nicht. Die Bundesbehörde vereint im Haus die Mitarbeiter:innen: von der Planung bis zu den ausführenden Organen, die Maßnahmen wie Quarantäne, Keulen oder Hygiene vor Ort durchführen.
VETMED: Sie haben schon angedeutet, dass sie kein Schreibtischtäter sind. Ein Kollege schreibt auf Linkedin über Sie: verlässlich und professionell, leading people and getting stuff done. Was vereint Ihr Verwaltungsjob alles?
Appelt: In meiner Rolle kann ich das Büro verlassen und an die Frontlinie fahren – das tue ich auch. Es hilft immer, wenn man die Auswirkungen seiner eigenen Pläne erlebt. Die Verwaltung tickt in der Mentalität insgesamt anders. Als gelernter Österreicher hatte ich eine Vorstellung, wie eine Behörde mit ihren Vorgaben und Regeln funktioniert. Im kanadischen System passiert viel im Konsens, obwohl das Gesetz die CFIA als zuständige Behörde ausweist. Hier wird in vielen Vorgesprächen mit allen Beteiligten das Vorgehen abgestimmt bevor es eine Vorschrift wird. Es gibt weniger den Hierarchie-Hammer und mehr amikale Gespräche mit Partnern und der Wirtschaft über den Plan, die Ziele und das Vorgehen. Dieses betont konsensorientierte Arbeiten war neu für mich.
VETMED: Über die Hürden bis zur Lizenz haben wir schon gesprochen. Wie gut hat sie die Ausbildung an der VetMed insgesamt auf Ihre Tätigkeiten vorbereitet?
Appelt: Die Ausbildung hat sich seit den 1990ern bestimmt verändert. Ich war im klinischen Jahr in Dublin an der Universität also in das angloamerikanische System eingebunden. Da wirst du praktisch gedrillt, um als Tierarzt gewisse Tätigkeiten sicher ausüben zu können. Du hast fix einen Platz im Praktikum und musst gewisse Standards erreichen. Es ist im Vergleich ein sehr verschultes System, mit Klassengemeinschaft und einem persönlichen Verhältnis mit den Lehrenden. An der Vetmed damals ging es um Eigenverantwortung, Planung, Vorausdenken und sich einen funktionierenden Lehrplan zu erstellen. Das fordert ein gewisses „Aufgewecktsein“, ist aber wesentlich anonymer. Ich habe ganz sicher von beiden Systemen profitiert.
VETMED: Auf ihrem Profilbild tragen sie einen Feuerwehrhelm. War es einfacher hier Fuß zu fassen, als bei der Anerkennung als Tierarzt?
Appelt: Ich habe mit 12 Jahren bei der Feuerwehrjugend begonnen. Meine Eltern dachten, das wäre nur eine Phase. Meine Engagement in Krems aufzugeben, war schwierig für mich. In Ottawa habe ich zunächst in einem Museumsverein historische Objekte restauriert. Im Stadtkern von Ottawa gibt es eine Berufsfeuerwehr, die umliegenden Gemeinden haben jeweils eine eigene Feuerwehr mit Teilzeitkräften, die heute über eine Handy-App organisiert sind. 2005 haben meine Frau und ich uns ein Haus am Stadtrand von Ottawa gekauft. Ich war unterwegs dorthin mit einem neuen Kühlschrank auf einem Anhänger, aber mein erster Weg führte mich zum Aufnahmegespräch für die Feuerwehr Ottawa „Rural Division“, wo ich mittlerweile Offizier (Lieutenant) bin. Grundaufgabe der Feuerwehr ist die unmittelbare Gefahrenbeseitigung z.B. leisten wir erweiterte Notfallhilfe bei lebensbedrohlichen medizinischen Notfällen, kommen nach Verkehrsunfällen und, natürlich, bei Bränden. Naturgefahren sind ein Thema: Überflutungen, Flurbrände und ein Tornado war auch schon dabei. Die Entfernungen sind im Vergleich enorm.
Was vermissen Sie an Krems?
Appelt: Abgesehen von Familie und Freunden? Die Mehlspeisen der Konditorei Raimitz.
Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.
Steckbrief:
-
FACHGEBIET: Geflügel
-
POSITIONSBESCHREIBUNG: Tierarztpraxis und fahrender Tierarzt
-
DERZEITIGER STANDORT: St. Andrä im Lavanttal/Kärnten
Wordrap:
-
Ich war an der Vetmeduni ... von 2013 bis 2019
Mein Tipp an Absolvent:innen der Vetmeduni ... Sich nicht unter Wert verkaufen, aber das ist heute den meisten ohnehin klar. Den Mut haben, Sachen anzugehen, verschiedene Fachbereiche auszuprobieren bis man den richtigen Bereich gefunden hat. Man muss nicht dort verharren, wo man geglaubt hat, hinzugehören. -
Mein Lieblingsort an der Vetmeduni ... waren die ÖH-Bar und der Sportplatz
Beschreiben Sie uns einmal Ihren Heimatort St. Andrä im Lavanttal. Wer sind Ihre tierischen und menschlichen Kunden und Kundinnen?
Andreas Meißl: St. Andrä ist eine Gemeinde mit rund 9.800 Einwohner:innen im Kärtner Bezirk Wolfsberg. Sie liegt in einem mittelbreiten Tal umgeben von Gebirge. Es wird viel Ackerbau betrieben, es gibt aber auch Geflügel-, Rinder- und Schweinebauern und -bäuerinnen. Meine Partnerin und ich führen die Praxis zu zweit. Wir betreuen Kleintiere im Ort wie eine Art Hausarzt. Ihr Spezialgebiet sind Rinder. Ich bin als Geflügeltierarzt im ganzen Bezirk von Lavamünd bis Reichenfels unterwegs und teilweise auch bis nach Mittelkärnten.
Sie wollten immer Tierarzt werden, haben davor aber einige Umwege genommen. Wie haben Sie Ihren Traumberuf letztlich verwirklicht?
Meißl: Ich habe die Hauptschule besucht und dann eine landwirtschaftliche Fachschule. Anschließend habe ich eine Mechanikerlehre mit Matura gemacht. Ich war Lehrling in einer Baufirma und habe Bagger, LKW, Autos, Straßenwalzen und Schubraupen repariert. In der Maturaschule habe ich mich einmal in der Woche auf meine Berufsreifeprüfung vorbereitet. Ich habe die für das Veterinärmedizinstudium verpflichtende Biologieprüfung abgelegt. Auch das Latinum habe ich nachgeholt. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und wurde bei meiner ersten Bewerbung angenommen. Am 9.September 2013 habe ich die E-Mail-Bestätigung meiner Aufnahme auf die Vetmed Uni bekommen und eine Woche später saß ich im Hörsaal für den Physik-Auffrischungskurs. Ich hatte mir also ein Ziel gesetzt und habe auch Glück gehabt.
Hatten Sie Vorbilder in dem Beruf?
Meißl: Als ich ein Kind war, hatten meine Eltern einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchkühen, Puten und Direktvermarktung von Brot, Käse, Topfen und Eiern. Dadurch habe ich immer wieder Tierarzt-Kollegen:innen bei der Arbeit in unserem Betrieb gesehen und war davon immer sehr beeindruckt.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Oder gibt es den gar nicht?
Meißl: Ein bissel Routine haben wir schon. Gerade die Geflügel-Bestandsbetreuung ist gut planbar. In der Rinderpraxis weiß man morgens manchmal nicht, wann der Tag enden wird und wie (lacht). Wir starten um 7:30 Uhr morgens, außer es ist bereits früher ein Notfall. Unter der Woche sind wir immer erreichbar und am Wochenende sind wir im Notdienstrad im Bezirk, also alle vier Wochen in Bereitschaft. Das funktioniert ausgezeichnet, da wir mit den Kollegen:innen im Bezirk sehr gut vernetzt sind.
Nach weiteren Stationen, über die wir noch sprechen werden, sind Sie in den Heimatort zurückgekehrt. Was haben Sie vorgefunden?
Meißl: Wir haben das schon etwas vorbereitet, da es immer mein Ziel war nach Kärnten zurückzukommen.
Die Einliegerwohnung im Elternhaus haben wir noch während des Studiums fertig gebaut. Ich wohne jetzt wieder direkt am Betrieb und habe für die Praxis 2022 ein Nebengebäude umgebaut. Das waren intensive Jahre, aber jetzt ist alles fertig.
Hat Sie das Studium gut auf eine eigene Praxis vorbereitet, auch im kaufmännischen Sinn?
Meißl: Man muss ein Generalist sein. Für Schweine und Geflügel wurden wir sehr gut vorbereitet, für andere Bereiche habe ich zu Beginn dazulernen müssen, damit ich fit werde als selbständiger Tierarzt. Im Nutztierbereich bin ich firm und sicher. Bei Pferden und Kleintieren kann ich mich und meine fachlichen Grenzen gut einschätzen – da überweise ich wenn nötig an spezialisierte Kolleg:innen weiter. Als Selbstständiger braucht man sehr viel Buchhaltung, Kostenrechnung und BWL. Die Uni gibt uns diesbezüglich leider sehr wenig Wissen mit auf den Weg. Durch meine Lehre und die Fachschule konnte ich in diesen Bereichen wesentlich mehr profitieren. Damals ist es mir langweilig und unnötig vorgekommen, aber es hat sich gezeigt: Man kann alles, was man gelernt hat, irgendwann einmal brauchen.
Welche Stationen und Praktika sind Ihnen besonders hängengeblieben – welche Erfahrungen waren neben dem Studium relevant?
Meißl: Besonders lehrreich war meine klinische Rotation an der Universität München, die ich während meines Studiums absolviert habe. Auch das Praktikum in einer Tierarztpraxis in Norddeutschland, welche auf Geflügelmedizin spezialisiert ist, war sehr eindrucksvoll. Sie betreut so viele Hühner, wie in ganz Österreich produziert werden. Für meine zukünftige Arbeit als Geflügeltierarzt habe ich davon enorm profitiert.
Im Bereich der Rindermedizin habe ich handwerklich viel in einem Praktikum bei Dr. Franz Schlederer gelernt. Auch während meines Wehrdienstes konnte ich als Heerestierarzt bei den Rottweilern in Kaisersteinbruch im Burgenland wertvolle Erfahrungen sammeln. Nach Abschluss meines Studiums war ich angestellt bei einem Kärntner Kollegen im Bereich der Geflügelmedizin und anschließend noch zwei Jahre in einer Tierklinik in Tirol tätig.
Was gefällt Ihnen an der Geflügelpraxis?
Meißl: An der Geflügelpraxis gefällt mir vor allem die Bestandsbetreuung – in meinem Fall meist Hühner, Enten und Gänse. Dabei geht es nicht nur darum die Bestände gesund zu erhalten, sondern auch ihre Leistung zu verbessern. Wenn Probleme auftreten, ist die Diagnosefindung eine nahezu detektivische Aufgabe, bei der die Betrachtung eines Gesamtbildes – Stallklima, Lüftungsanlage, Temperatur, Fütterung etc. – eine wesentliche Rolle spielt.
Wie sieht es mit der Work-Life Balance aus, gerade weil Sie als Paar in der gleichen Praxis arbeiten? Wie ergänzen Sie sich?
Meißl: Da meine Partnerin und ich gemeinsam tätig sind, können wir unser Praxisgebiet zur Zufriedenheit unserer Kunden abdecken. Allein wäre dies sicher schwer möglich. Wir haben zwei ausgestattete Praxisautos, mit denen wir unsere Patienten auch an weit entfernten Orten betreuen können. Die Kleintierordination machen wir meistens gemeinsam, ebenso große Operationen. Es ist schön und eine Bereicherung, wenn man einen Austausch bei der Arbeit hat. Natürlich ist man als Selbstständiger selbst und ständig bei der Arbeit, jedoch können wir uns durch die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen:innen im Bezirk auch unsere freien Tage herausnehmen.
Im Bezirksblatt ist zum heimgekehrten Sohn der Gemeinde gleich ein Bericht erschienen – wie war es zur Nachricht zu werden?
Meißl: Spannend! In den Medien kommt nicht immer genau das an, was man meint. Einige Folgeberichte waren teilweise falsch. Es ist für mich völlig neu, dass mich plötzlich mehr Leute kennen – daran muss ich mich erst gewöhnen.
Welchen Rat geben Sie Studierenden?
Meißl: Sich nicht verrückt machen lassen und auf das Feiern und die Freude nicht vergessen. Die interessantesten Möglichkeiten fürs Leben ergeben sich nicht im Hörsaal. Türen gehen sowohl in Fortbildungen als auch bei Praktika auf, wenn man dafür offen ist und mit den Leuten redet.
Was ist Ihre Devise – worauf können sich Ihre Kund:innen verlassen?
Meißl: Wenn ich sage, dass ich erreichbar bin, dann bin ich das auch. Ich bin stets zuverlässig und freundlich und nehme mir für die Patienten und Patientinnen ausreichend Zeit.
(Das Interview hat Astrid Kuffner geführt. Stand Q4/2023)
Steckbrief:
-
FACHGEBIET: Virologie
-
POSITIONSBESCHREIBUNG: Professor für Virologie und Leiter der Massensprektrometrie Core Facility an der School of Medicine der TU München
-
DERZEITIGER STANDORT: München (Deutschland)
Wordrap:
-
Ich war an der Vetmeduni ... von 1996 bis zum Doktorat 2003
Mein Tipp an Absolvent:innen der Vetmeduni ... Wenn man sich für etwas interessiert, schafft man alles. Das trägt einen sehr und lange. Ein Ziel vor Augen haben und dafür die nächsten weiteren Schritte kennen. -
Mein Lieblingsort an der Vetmeduni ... das Labor der Virologie und die ÖH-Bar.
Was hat Sie an die Vetmeduni geführt? Ein klassischer Tierarzt sind Sie nicht geworden. War das einmal ein Ziel?
Andreas Pichlmair: Eigentlich wollte ich Tierarzt werden, seit ich fünf Jahre alt war. Mein Vater war ein Großtierarzt mit eigener Praxis in Oberzeiring, einem Dorf in der Obersteiermark. Den Beruf fand ich schön und faszinierend. Vor allem, wie neues Leben entsteht, hat mich gefesselt. Alles, was mit Zucht, Reproduktionsmedizin und Geburten zu tun hat, aber auch Erkrankungen. Als ich mit dem Studium begann, wurde das Schaf Dolly kloniert. Ich bin an die Uni gegangen mit der Perspektive eine gewisse Zeit zu bleiben und zu forschen, hätte aber nie gedacht, dass ich einmal Professor an einer medizinischen Fakultät werde. Im Curriculum der Vetmeduni bin ich an den vorklinischen Fächern, insbesondere an der Virologie, hängengeblieben.
Was hat Sie geprägt in dem Umfeld? Woran merken Sie das heute noch?
Pichlmair: Der Blickwinkel auf Erkrankungen aus einer medizinischen Fachrichtung hat mich geprägt. Es haben sich in der Veterinärmedizin nicht viele Studierende auf Virologie und Infektionsmedizin spezialisiert. Ich habe mit diesem Interesse am Campus gleichsam offene Türen eingerannt und viel Unterstützung bekommen. Das hat mich bestärkt im Karriereweg. Für die Unterstützung einzelner Professoren bin ich nach wie vor sehr dankbar.
Was hat Sie an der Virologie so gepackt und wie kam es zu der weiteren Spezialisierung?
Pichlmair: Wenn man die Faszination für die Sache spürt, ergeben sich die Wege. Viren sind sehr kleine Pathogene mit wenigen Genen, die enorme Auswirkungen auf den Gesamtorganismus haben. Wie kann ein Organismus mit so limitierter Codierungskapazität menschliche Zellen mit 20.000 Genen infizieren und die Strukturen zur Reproduktion kapern? Diese Beziehung und Interaktion sind hoch interessant und unzureichend verstanden. Kommt es zu einer Infektion oder nicht? Erholt sich der Wirt oder verschlimmert sich das Krankheitsbild? Was sind die Determinanten eines negativen Krankheitsverlaufes? Wir sehen uns das heute auf Ebene der Proteinexpression in den Zellen an (Proteomics). Es ist ein komplexes Themengebiet, das die Erfahrungen aus meinen verschiedenen Wirkungsstätten vereint.
Wie Sie nach Wien kamen, haben wir besprochen. Aber wie ging es weiter mit dem Doktorat am Department für Virologie der Universität Freiburg (2002) und zum PhD bei Cancer Research UK in London (2004)?
Pichlmair: An der Vetmeduni haben wir mit retroviralen Vektoren für den Gentransfer gearbeitet, um Therapien zu entwickeln. Beim Wechsel nach Freiburg habe ich als erster aufgezeigt, als jemand gesucht wurde, der ins dortige Virologie-Labor gehen möchte. Die renommierte Uniklinik dort brachte den Wechsel in die Humanmedizin und zur Interaktion von Eiweißmolekülen mit durch Luft übertragene Erreger wie Influenza, die für Mensch und Tier wichtig sind. Es gar nicht einfach, die kritischen Meilensteine auf dem Karriereweg festzumachen. Es war wohl letztlich genauso wichtig Studienassistent zu sein, wie sich um die Professur zu bewerben.
Sie leiten die Massenspektrometrie Core Facility an der TU München. Wann und wie ist diese Technologie in ihr Leben getreten?
Pichlmair: Für den PhD bin ich nach London gegangen und habe dort v.a. am angeborenen Immunsystem gearbeitet. Danach stellte sich die Frage welche komplementären Technologien sich dazu eignen die Forschung am Gebiet weiterzubringen. Ich hatte das Glück, Giulio Superti-Furga kennenzulernen, der mich ans Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) in Wien geholt hat. Dort haben wir die Proteomik in Zellen mit Massenspektrometrie erforscht. Ein fantastisches Tool, um Proteine zu identifizieren, dabei auch geeignet, neue molekulare Mechanismen zu entdecken, die nicht auf der Hand liegen. Es gibt Leute, die sagen, dass man mit den -omics-Technologien hypothesenfrei arbeiten kann. Das sehe ich nicht so. Wir hatten klare Vorstellungen, was wir identifizieren wollen, und welche wichtigen Fragen wir mit dieser Technologie beantworten möchten. Die Massenspektrometrie erlaubt Einblick in ein größeres Bild, aber man braucht schon eine konkrete Vorstellung, was dort zu sehen sein kann.
Wie hat Sie die Ausbildung an der Vetmeduni auf ihr aktuelles Arbeitsgebiet vorbereitet?
Pichlmair: Ich glaube, man brauchte ein Fundament, auf das man aufbaut. Bei mir ist es das Verständnis für den Organismus und physiologische Vorgänge im Körper. Auch wenn wir heute an kleinen Molekülen arbeiten steht immer die Frage dahinter, wie sich das auf den Organismus und das Krankheitsgeschehen auswirkt.
Ist die Leitung der Core Facility vor allem eine Frage der Administration, oder sind Sie über die Methodik in ganz viele Fragestellungen eingebunden?
Pichlmair: Wir haben am CeMM rasch das Potenzial der Proteomics gesehen. Dieses Know-how habe ich dann am Max-Planck-Institut für Biochemie erweitert. Als ich den Ruf an die TU München bekommen habe, war eines der Ziele, dass wir den Bereich hier aufbauen und der lokalen Forschungslandschaft zur Verfügung stellen. Die Facility selbst bedeutet natürlich einiges an Administration. Wir sind neben unseren eigenen Projekten unterschiedlich stark involviert, teilweise nur als Dienstleister aber auch als aktive Kollaborationspartner. In der Wissenschaft sind wir keine Einzelkämpfer – die Core Facility ist ein Paradebeispiel dafür. Der Großteil meiner Arbeitszeit fließt aber in eigene Forschung und natürlich die Lehre. Ich unterrichte Virologie an der School for Life Sciences. Wir gewinnen dort auch Studierende, die bei uns mitarbeiten wollen und ich sehe es als eine meiner Aufgaben, ihre Karrierewege zu unterstützen. Im Hinterkopf habe ich oft, wie wichtig es für mich war Unterstützung in dieser Phase meiner Ausbildung zu bekommen, um das umzusetzen, was ich als wichtig erachtet habe.
Wir haben noch nicht über Ihre aktuelle Forschung geredet. Sie haben nach einem Consolidator Grant 2018 im Jahr 2022 einen Proof of Concept Grant des European Research Council zugesprochen bekommen. Was ist das Thema dieser Grundlagenforschung?
Pichlmair: Viren infizieren Zellen und bauen ihre Strukturen stark um, um sie zur eigenen Vermehrung verwenden können. Unter anderem ist die Proteinsynthese wichtig und wir sehen uns in vereinfachten zellulären Modellen an, welche Effekte Viren auf die Eiweißmoleküle in der Zelle haben. Welche Signalwege sich verändern oder welche Gegenmaßnahmen die Zelle trifft, um die virale Infektion zu unterbinden. Die Protein-Abundanz, also die Häufigkeit und Dichte sowie ihre Stabilität kann man nur mit Massenspektrometrie charakterisieren. Wir beobachten auf dieser Ebene wichtige regulatorische Mechanismen, die noch nicht gut verstanden sind.
Eine Virusinfektion induziert eine Fülle komplexer Prozesse, die wir im Modell aufzuklären versuchen. Validiert werden sie in komplexeren Experimenten in Patient:innen oder Tiermodellen. Ein Gesamtbild der realen Vorgänge werden wir in unserer Lebenszeit vermutlich nicht gänzlich erforschen können. Wir konzentrieren uns auf Aspekte, die man charakterisieren kann und die einen therapeutischen oder diagnostischen Nutzen haben können. Wir müssen das reduzieren und dabei nicht vergessen, dass es nur ein Teil des Bildes ist. So versuchen wir den großen Graben zwischen Anwendung und Forschung zu überbrücken.
Was vermissen Sie an Österreich, seit Sie den Lebensmittelpunkt nach München verlegt haben?
Pichlmair: Der Schmäh geht mir etwas ab. Das ist schon etwas Besonderes an der österreichischen Mentalität: der leichtere, lockere Umgang mit schweren Sachen. Vielleicht gründe ich hier noch eine Core Facility für Schmäh.
(Das Interview hat Astrid Kuffner geführt. Stand Q4/2023)
Veterinärmedizinerin Barbara Forstner - die vielseitige Tierärztin
Wollten Sie immer schon Tierärztin werden?
Barbara Forstner: Nein! Ich bin als Bücherwurm auf dem väterlichen Schweinemastbetrieb in Oberösterreich aufgewachsen. Meine Traumvorstellung war, Lektorin in einem Buchverlag zu werden, also fürs Bücherlesen bezahlt zu werden. Auf Wunsch meiner Eltern habe ich die HBLA Elmberg absolviert, aber auch sonst waren Tiere in meiner Kindheit und Jugend bei aller Bücherliebe permanente Begleiter. Ich habe Praktika auf einer Alm mit Milchkühen gemacht und war in Schweden auf einem Schafbetrieb. Zuhause ging es weiter. Keine Babykatzen im Bett zu haben, war die Ausnahme. Meine Mutter ist Lehrerin und ihr war wichtig uns Kindern Naturverbundenheit zu vermitteln. Sie hielt Hühner und Enten. Mein Vater war Jäger und brachte immer wieder verwaiste Rehkitze mit, die wir von Hand aufzogen. Wir hatten einen Hund und viel Platz, sodass wir – vom Wellensittich bis zum Aquarium – alle möglichen Tiere halten konnten. Ich durfte auf dem Nachbarhof reiten lernen und habe dort bald jede freie Minute mitgearbeitet. Inmitten dieser permanenten Praxiserfahrung mit ganz verschiedenen Tieren reifte der Wunsch mich hier weiterzubilden. Ich habe die Aufnahmeprüfung an der Vetmeduni beim ersten Antritt geschafft. Meine Eltern haben mich nur noch selten gesehen, weil ich nebenbei immer viel Praxis gesammelt habe. Mein Bruder hat dankenswerterweise den Betrieb übernommen. Und ich übe heute meinen Traumberuf aus.
Das ist bestimmt eine gute Vorbereitung gewesen. Im Tierpark der Stadt Haag leben ja Vögel, Fische, kleine und große, heimische und exotische Tiere, verschiedene Fleisch- und Pflanzenfresser. Was gehört als zoologische Leiterin des Tierparks zu Ihren Aufgaben?
Forstner: Wir sind insgesamt etwas über ein Dutzend Leute in der Tierpflege und Instandhaltung, also ein kleines Team. Daher ist jeder für alles zuständig. Die zoologische Leitung habe ich im Jänner 2023 als Nebentätigkeit auf Werkvertragsbasis übernommen. Die Stelle war ausgeschrieben und ich habe mich im Hearing unter rund 15 Bewerber:innen bewähren können. Als Zootierärztin ist man nicht Tierarzt von Zootieren, sondern Lebensraumgestalter für sehr viele Arten. Zuständig vom Management von Parasiten, bis zur Reproduktionsplanung, der Teilnahme an Arterhaltungsprogrammen mit der ganzen Dokumentation und Registrierung, Populationsmanagement, Zuchtplanung – das ist also ein sehr breites Spektrum. Auch die Entnahme für Tiere aus unserem Bestand, um sie zu verfüttern, gehört zu meinen Aufgaben.
Im Hauptberuf sind Sie fahrende Tierärztin mit eigener Praxis. Wie kam es dazu?
Forstner: Ich habe relativ rasch nach dem Studium mit 26 Jahren meine Praxis eröffnet. Davor habe ich bereits fünfeinhalb Jahre bei Karl Auinger in St. Valentin, der mein Vorgänger als zoologischer Leiter war, mitgearbeitet. Der war vom alten Schlag und hat mich in viele Behandlungen eingebunden: im Zoo und im Stall. Es gibt für mich nicht viel, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Seit März 2021 bin ich selbständige Tierärztin in Stadt Haag. Das war eine „jetzt-oder-nie“- Geschichte. Das Praxisgebäude wurde nahe dem Tierpark gebaut und die Stadt Haag wollte eine Tierärztin/einen Tierarzt im Ort. Ich mache etwa auch die Fleischbeschau. Ich wollte das Geschäft zum Laufen bringen, bevor ich Kinder bekomme. Meine Tochter ist im Dezember 2022 auf die Welt gekommen.
Hat Sie die Uni gut auf ihre beiden Berufsfelder vorbereitet?
Forstner: Ich habe im Studium nicht das Wildlife und Conservation Management Modul belegt, aber ein halbes Jahr bei Thomas Voracek, dem Leiter der Zoodocs in Schönbrunn, mitgearbeitet. Ich habe stattdessen das Vertiefungsmodul Lebensmittelwissenschaften, öffentliches Veterinär- und Gesundheitswesen (LöVG) gemacht. Das kommt mir heute sehr entgegen, denn Bürokratie und Kontakt zum Amt sind Teil meines Arbeitslebens. Im Herbst 2023 hatten wir in der Region Vogelgrippe-Alarm. Wir haben alle unsere Vögel im Tierpark eingesperrt, aber wir haben etliche Wasserflächen, wo Wildvögel auch hinkommen. Berichtspflichten, Testungen und Sicherheitsauflagen für Mitarbeiter:innen zu erfüllen. Ich kann nur sagen: das Modul hat da nicht geschadet.
Was war der aufregendste Notfall? Im Tierpark leben ja auch Löwe, Leopard, Tiger und Braunbär.
Forstner: Koliken oder Geburten, da wirst du als Tierärztin gerufen. Im Tierpark sind Notfälle nicht so häufig, vieles ist vorhersehbar. Manchmal gibt es hässliche Verletzungen. Der schönste Notfall, bei dem ich assistieren durfte, war ein Kaiserschnitt bei einer Leopardin - das war ein Nervenkitzel. Die Kleinen haben leider nicht überlebt, aber die Leopardin wurde wieder schwanger. Der springende Punkt ist: ich bin keine Fachtierärztin, sondern zuständig in Feld, Wald und Wiese – die Doktorin und das liebe Vieh. Als Zootierärztin muss ich flexibel sein und bin mit viel Herzblut dabei. Ich arbeite sehr breit und oft muss ich erfinderisch sein. Die Bedingungen und das Tier selbst bestimmen den Rahmen. Es gibt oft keine 0815-Medikation oder Verabreichungsform. Da muss ich herumprobieren. Neulich habe ich getrocknete Mangos, die meine Tochter dabeihatte, erfolgreich bei einem Nasenbären eingesetzt. Vor einiger Zeit haben wir im Blutbild einer alten Großkatze eine Entzündung gesehen und auf eine Pankreatitis getippt. Als wir sie narkotisiert hatten, sahen wir, dass sie eine Zahnwurzelbehandlung braucht. Da musste ich kreativ werden. Denn das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich habe nur die 40 Minuten, wo sie gut schläft. Ich habe den abgebrochenen Zahn versorgt und kürettiert. Zudem kann ich postoperativ nicht täglich spülen und reinschauen. Es gab danach zum Glück keine Probleme. Manchmal brauchen wir Mut zur Lücke. Perfektion ist nicht immer möglich, aber ich bilde mich in verschiedenen Bereichen beständig weiter.
Neben dieser Beherztheit, Erfindungsgeist und Bescheidenheit brauchen Sie wohl auch scharfe Munition...
Forstner: Das Betäubungsgewehr ist wohl mein bester Freund im Umgang mit den Wildtieren und im täglichen Gebrauch. Die scharfe Waffe für Notfälle ist noch nie notwendig gewesen. Ich habe den Jagdschein und den Waffenschein in Wien während des Studiums gemacht
Was sehen Sie als bisherigen Erfolg – worauf sind Sie stolz?
Forstner: Ich freue mich, dass ich ein Superteam habe, auf das ich mich verlassen kann. Ich handle nach der Maxime, die ich im Studium auf einem Kongress der internationalen Vereinigung der Zootierärztinnen und -ärzte mitgenommen habe. Da waren einige Vortragende, die am Ende ihrer Fallpräsentationen eingestanden haben, dass man es sicher besser hätten machen können. Diese Zunft ist nicht abgehoben und meint nicht für alles die beste Lösung schon parat zu haben. Ich spreche also sehr viel mit umliegenden Tierärzten und Tierärztinnen und tausche mich auch mit Spezialist:innen über mögliche optimierbare Lösungen aus.
Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?
Forstner: Ich wecke meine Tochter, wir frühstücken und fahren in den Tierpark für die tägliche Rundfahrt. Ich bin derzeit eineinhalb Stunden pro Tag in der Ordination. Wenn ich komplexe Eingriffe habe, übernehmen Oma oder Papa unsere Tochter. Der ehemalige zoologische Leiter ist mein Vertreter und wenn ich absehbar Fachexpertise brauche, ziehe ich Kolleg:innen hinzu.
Vetmeduni: Danke für das Gespräch!
(Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.)
Masterabsolventin Annika Bremhorst (Mensch-Tier-Beziehung/Human–Animal Interactions)
Sie haben zunächst Verhaltensbiologie studiert und ihre Bachelorarbeit über Makaken verfasst. Wie sind Sie auf den Hund gekommen?
Bremhorst: Schon vor dem Studium. Ich bin eine „Canine Scientist“, Hunde sind meine Kernforschungsspezies. Ich fand sie von klein auf faszinierend und wir hatten selbst einen Hund. Nach der Matura habe ich eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht und so auch das Geld für mein Studium verdient. Ich wollte noch mehr über die Spezies lernen und ihr Verhalten erforschen. Mit meiner Bachelorarbeit an der Universität Göttingen habe ich meine erste eigene Forschungsstudie im Bereich Verhaltens- und Kognitionsbiologie durchgeführt und dabei viel gelernt, was auch für meine Hundeverhaltensforschung relevant war.
Sie sind also von Stuttgart zum Studium nach Göttingen und haben sich 2012 als eine der Pionierinnen im Interdisciplinary Master of Animal Human Interaction (IMHAI) eingeschrieben. Wie kam es zum Wechsel nach Wien?
Bremhorst: Während der Bachelorarbeit habe ich ein Info-Mail zu diesem Masterstudium bekommen. Als ich vom „Clever Dog Lab“ gelesen habe, dachte ich mir: Das ist perfekt für mich. Wir waren im ersten Jahrgang ausschließlich Studentinnen mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, wurden aber in jede Richtung unterstützt und konnten eine breite Basis zu Kognition und Verhalten, Tierethik, komparative Medizin für Mensch und Tier und Animal Welfare aufbauen. Ich habe in meiner Masterarbeit Empathie bei Hunden erforscht – also wie sich die Stimmung durch emotionale Laute von Menschen und anderen Hunden auf Hunde überträgt. Nach dem Abschluss war mir klar, dass ich einen PhD machen möchte, um meine Forschung weiterführen zu können.
Ihr Weg führte weiter an die Universitäten Bern (Schweiz) und Lincoln (England) für ein Joint PhD Degree. Wie können wir uns das vorstellen?
Bremhorst: Während der Masterarbeit wurde mir bewusst, dass wir über das emotionale Ausdrucksverhalten von Hunden noch nicht sehr viel wissen – ein Thema, das mich interessierte. Die Gruppe von Hanno Würbel an der Universität Bern und die von Daniel Mills an der University of Lincoln sind bekannt für die Erforschung von Animal Welfare, Behaviour, und Emotions; in Lincoln ist zudem Verhaltensmedizin im Fokus.
Als sie eine Stelle für ein gemeinsames Doppeldoktorat Projekt ausgeschrieben haben, habe ich zugegriffen. Ich habe beide Graduiertenschulen besucht (2016 bis 2019) und die Prüfungen gemacht, hatte an beiden Standorten Supervisoren und habe an beiden Unis gleichzeitig promoviert mit einer Arbeit über den Ausdruck von Emotionen in der Mimik von Hunden. Im letzten Jahr des Doktorats habe ich auch mein erstes Kind bekommen und 2021 den Abschluss gemacht.
Das klingt herausfordernd. Wie ging es weiter?
Bremhorst: Ich hatte ein Post-Doc Funding in England zugesagt bekommen, konnte das mitten in der Pandemie aber nicht antreten. Da bin ich einen Schritt zurückgetreten und habe mich gefragt, warum ich mich auf meine akademische Reise gemacht habe. Mir war klar: Ich komme aus der Praxis, ich liebe Forschung zu Hunden und möchte wissenschaftliche Ergebnisse hinaustragen. Das interessiert so viele Hundehalter:innen! Ich habe mich also in den vergangenen zwei Jahren in der Wissenschaftskommunikation weitergebildet und habe Anfang 2022 meine Firma „Dogs and Science“ gegründet.
An der Schnittstelle von Hundeverhalten, Emotionen und Wohlbefinden bieten Sie Forschung, Wissenschaftskommunikation und Training an. Wie funktioniert das?
Bremhost: Es ist alles noch im Aufbau. 2022 ist mein zweites Kind zur Welt gekommen und ich musste einen Weg finden, der zu mir und meinem Leben passt. Um weiter forschen zu können habe ich gleichsam mein eigenes Forschungsinstitut gegründet. Und ich bin da nicht die Einzige. Ich stehe mit zwei Kolleginnen in Kontakt, die es auch so gemacht haben – wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn es mir gelingt auf diese Weise ein Einkommen zu generieren, möchte ich selbst Preise für Forschung vergeben. Das ist noch Zukunftsmusik, aber ich möchte zurückgeben, was ich auch bekommen habe.
Wie wurde an der Uni damit umgegangen, dass Sie Forscherin und Mutter sind?
Bremhorst: In der Hundeforschung sind sehr viele Frauen. Man braucht das Verständnis der anderen für die Situation – Kolleg:innen mit Kindern kennen das. Ich arbeite also weiter – großteils remote – als Associate Researcher am „Tech4animals Lab“ der Universität in Haifa (Israel) und der University of Lincoln. Die enge Zusammenarbeit auf große Distanzen klappt sehr gut. Im PhD-Programm wurde mir immer wieder geraten, „mal ein bisschen langsamer zu machen“. Ich versuche mitzuhalten, muss aber einen Gang zurückschalten. Mein Sohn war während der Wissenschaftskommunikations-Ausbildung in vielen Online-Meetings dabei. Das war kein Thema und er winkt zum Abschied immer.
Ein Spezialgebiet von Ihnen ist KI in der Verhaltensforschung. Was hat es damit auf sich?
Bremhorst: Ich habe 2019 während meines PhD einen ersten Workshop zur Verknüpfung von Computer Science und Verhaltensforschung an der Universität Bern organisiert. Der stieß auf großes Interesse. Durch mehrere Kollaborationen mit Anna Zamansky, Computer Scientist und Leiterin des Tech4Animals Labs der Universität Haifa, habe ich dieses Interesse weiterverfolgt. Wir haben Daten aus meiner Dissertation mit Labrador Retrievern in ein erstes KI-Modell eingespeist, das die emotionale Mimik beim Hund erkennen soll. Bei Katzen sind wir schon weiter, aber Hunde sehen so unterschiedlich aus. Sie kommunizieren über Mimik und Körpersprache, aber teilweise sehr subtil. Das ist nicht leicht zu beobachten. Das Ziel ist, ein solides KI-Modell zu entwickeln, dass emotionales Ausdrucksverhalten bei Hunden zuverlässig erkennen kann und vielleicht praktisches Wissen empirisch zu belegen.
Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?
Bremhorst: In den vergangenen Jahren habe ich durch meine Kinder die meiste Arbeit zwischen 19 Uhr und 1 Uhr Früh erledigt: Forschungsanträge schreiben, Studien planen, Datensammeln und auswerten, Artikel schreiben, Workshops für Science Communication planen, und so weiter. Meine Aufgaben sind wirklich sehr vielfältig – ich arbeite an einer Reihe von Forschungsprojekten mit internationalen Kolleg:innen verschiedener Universitäten, dazu kommt meine Firma also der unternehmerische Bereich, den ich abdecken muss.
Auch wenn Sie einen Gang zurückgeschaltet haben, sind Sie mit viel Drive unterwegs. Was motiviert Sie dazu?
Bremhorst: Es fasziniert mich und macht mir Spaß, sonst würde ich das nicht durchhalten. Ich habe viel gekämpft, um diesen Weg gehen zu können. Es ist einfach mein Thema seit Kindertagen. Ich war die Erste aus meiner Familie an der Uni, musste mich einsetzen und widersetzen. Das gebe ich nicht so einfach auf und versuche stattdessen einen Weg für mich zu finden, meine Hundeverhaltensforschung fortzuführen.Wissenschaftliche Institutionen bieten derzeit oft noch wenig Flexibilität, sich an veränderte Lebenswelten anzupassen.
Vetmeduni: Danke für das Gespräch!
(Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.)
Klara Klein - Forschung ist eine faszinierende Reise
Wussten Sie schon immer, dass Sie Wissenschafterin werden wollen?
Klein: Schon in der Schule habe ich mich für Naturwissenschaften, vor allem für Biologie, interessiert. Gleichzeitig hatte ich immer den Wunsch, etwas zu tun, das einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat. Ehrlich gesagt, hatte ich zuerst keine genaue Vorstellung davon, was es bedeutet, Wissenschafterin zu sein. Ich habe zuerst Humanmedizin studiert. Habe aber bald gemerkt, dass mir die Forschung mehr liegt als die Klinik. Deshalb habe ich nach einem Studium gesucht, das mir erlaubt frühestmöglich Laborerfahrung zu sammeln. Das Bachelorstudium Biomedizin und Biotechnologie an der Vetmeduni war dafür genau das Richtige und war somit der erste Schritt für meinen Karriereweg als Forscherin.
Was hat Ihnen am Bachelorstudium an der Vetmeduni besonders gefallen?
Klein: Der Vorteil an diesem Studium war, dass ich früh sogenannte „Wet Lab Skills“ erlernen konnte, also praktische Laborerfahrung. Im Rahmen von „Projektmitarbeiten“ hatte ich schon als Bachelorstudentin die Möglichkeit direkt mit erfahrenen Wissenschafter:innen an laufenden Projekten zu arbeiten und habe so direkte Einblicke in das Berufsbild bekommen.
Worin liegt für Sie der Reiz an der Tätigkeit als Forscherin?
Klein: Es ist eine faszinierende Reise des ständigen Hinterfragens, des Umkehrens von Konzepten und der Vertiefung in unbekannte Mechanismen. Es geht darum, immer mehr vielleicht sogar etwas völlig Neues zu entdecken. Die Forschung erfordert Leidenschaft, Neugier, aber auch einen guten Anteil Frustrationstoleranz. In meinem Spezialgebiet reizt mich vor allem die Aussicht, dass die eigene Arbeit einmal Patient:innen helfen könnte.
Worauf haben Sie sich im Laufe Ihrer Ausbildung spezialisiert?
Klein: Im Bachelorstudium entdeckte ich mein Interesse für Immunologie und insbesondere für die sogenannten natürlichen Killerzellen (NK-Zellen). Die brachten mich zur Schnittstelle Immunologie und Krebsforschung, und ich entschied mich für einen Masterstudiengang in "Molecular Biosciences" mit Schwerpunkt "Cancer Biology" am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Während meines Masters habe ich auch noch ein Praktikum am Broad Institute in Boston gemacht, wo ich die faszinierende CRISPR/Cas9-Technologie kennenlernte. Danach zog es mich wieder nach Wien, wo ich im PhD-Programm "Inflammation and Immunity" an der MedUni studiert und im Labor von Prof.in Veronika Sexl an der Vetmeduni an meinem PhD gearbeitet habe.
Kurz gesagt, ich habe mich auf Immunologie spezialisiert und bin fasziniert von der komplexen Rolle unseres Immunsystems. Meine Motivation war und ist es, zu einem besseren Verständnis des Immunsystems beizutragen und neue Ansätze zu entwickeln, um unser Immunsystem so zu modulieren, dass wir Krankheiten besser therapieren können.
Seit 2022 arbeiten Sie als Senior Scientist im Start-up Cutanos. Sie haben also die Universität verlassen. Was war dafür ausschlaggebend?
Klein: Mit Abschluss des Doktorats stellt sich natürlich die Frage nach der weiteren Zukunft. Da langfristige Perspektiven an der Universität nicht immer gegeben sind, habe ich mich umgeschaut, welche Berufsoptionen außerhalb der Uni bestehen. Mir war es wichtig, in der Forschung zu bleiben und weiterhin als Wissenschaftlerin in meinem Spezialgebiet, der Immunologie, tätig zu sein. Ich wollte meine bisherige Expertise einbringen, ausbauen und mich gerne mehr auf die angewandte Forschung konzentrieren. Genau das bietet mir der Job bei Cutanos.
Was unterscheidet die Arbeit im Start-up von der Forschung an der Uni?
Klein: Die Arbeit im Startup ist im Grunde ähnlich wie das, was ich schon von der Universität gewohnt war. Der Fokus der Forschung liegt, statt in den Details der Grundlagenforschung und dem Publizieren, auf der möglichst raschen Entwicklung angewandter Therapieansätze.
Ich bin im Start-up für ein bestimmtes Projekt verantwortlich, plane eigenständig Experimente und führe sie mit Unterstützung des Teams durch. Die Daten werden analysiert, interpretiert und dann unseren Investor:innen und Kollaborationspartner:innen kommuniziert.
Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit, umfassender involviert zu sein. Das spornt mich besonders an, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. In einem kleinen Unternehmen trägt man schneller mehr Verantwortung und es entsteht ein größeres Gemeinschaftsgefühl. Projektplanung, Strategieentwicklung und Kommunikation sind dabei dauerhafte und wichtige Aufgaben.
Hat Sie die Ausbildung auf das Start-up Leben vorbereitet?
Klein: In meinem aktuellen Job wurden definitiv meine Fähigkeiten gesucht. Während meiner Ausbildung habe ich gelernt, meine Forschung verständlich zu vermitteln, kritisch zu denken und neue Strategien zu entwickeln, wenn Dinge einmal nicht wie geplant funktionieren. Aber man lernt nie aus und ich erweitere ständig meine Skills.
Woran arbeiten Sie bei Cutanos?
Klein: Bei unserer Arbeit dreht sich alles um die Entwicklung innovativer, zielgerichteter Immuntherapien. Wir haben ein kleines Molekül entdeckt, das spezifisch an Langerhans Zellen, einen Subtyp von dendritischen Zellen in der Oberhaut, bindet. Unsere Plattformtechnologie ermöglicht es, verschiedene Antigene oder Wirkstoffe an dieses Molekül anzukoppeln. Durch eine minimalinvasive Anwendung über die Haut können diese gezielt zu den Langerhans Zellen transportiert werden.
Langerhans Zellen spielen sowohl eine Rolle in der Induktion aktiver Immunantworten gegen Krankheitserreger als auch bei der Etablierung von Toleranz gegenüber Autoantigene. Somit hat unser Immuntherapieansatz Potenzial für die Entwicklung von Impfstoffen sowie in der Therapie unterschiedlicher Erkrankungen, inklusive Allergien und Autoimmunerkrankungen.
Haben Sie als Frau in ihrem bisherigen Karriereweg (noch) mit stereotypen Vorurteilen zu tun gehabt?
Klein: Ich selbst hatte das Glück, keine direkte Diskriminierung als Frau erlebt zu haben. Ich habe während meiner Ausbildung zumeist in frauendominierten Laboren gearbeitet und auch weibliche Vorgesetzte gehabt. Ich bin dankbar für diese Vorbilder und denke dennoch, dass es in Punkto Gleichstellung – insbesondere in Führungspositionen – noch viel Arbeit gibt. In dem Zusammenhang möchte ich auch den Dokumentarfilm "Picture a scientist" aus dem Jahr 2020 von Ian Cheney und Sharon Shattuck erwähnen, der die Geschlechterdiskriminierung in der Wissenschaft thematisiert.
Wie sieht ein gewöhnlicher Arbeitstag bei Ihnen aus oder gibt es den nicht?
Klein: Meine Arbeit findet entweder im Labor oder im Büro statt. Die Experimente müssen natürlich vorher genau geplant und anschließend analysiert und präsentiert werden. Einen festgefahrenen Arbeitsablauf gibt es jedoch nicht und es kann auch manchmal sehr spontan werden. Wir haben häufig dynamische Diskussionen, Troubleshooting- und Brainstormingssessions im Team. Das bringt Abwechslung und macht den Arbeitsalltag nie langweilig.
Vetmeduni: Danke für das Gespräch!
(Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.)
Birgit Dastig – Allrounderin am Land und zertifizierte Hundetrainerin
Vetmeduni: Wussten Sie immer schon, dass Sie Tierärztin werden wollen?
Birgit Dastig: Das war mein Berufswunsch seit ich sechs Jahre alt war. In meiner Familie gab es da kein direktes Vorbild. Ich bin in Schwarzach aufgewachsen, habe aber als Kind viele Sommer auf der Alm im Rauriser Tal verbracht und mit meinen Eltern Herden gehütet. Das hat mich geprägt.
Vetmeduni: Sie leiten gemeinsam mit einer Kollegin das Tiergesundheitszentrum (TGZ) in Ragnitz mit angeschlossenem Physiotherapiezentrum und Hundefrisör. Wie ist das gelungen?
Dastig: Ich bin nach dem Studium über ein Praktikum in Oberösterreich und eine Stelle als Assistentin in einer Rinder- und Schweinepraxis in die Südsteiermark gekommen. Die Landwirte vor Ort haben mich bald gefragt, ob ich nicht in der Gegend bleiben möchte. 2004 habe ich mich selbständig gemacht, mit einer Ein-Raum-Praxis und meinem Mann als Sprechstundenhilfe. Uns wurde jedoch schnell klar, dass wir mehr Platz brauchen und so beschlossen wir zwei Jahre später eine neue Praxis zu bauen. Seit 2009 leiten Manuela Scherwitzel-Mandl und ich das TGZ gemeinsam. Bis vor wenigen Monaten konnten wir in der Region auch einen 24 Stunden Notdienst aufrechterhalten. Da leider die benachbarten Kollegen und Kolleginnen ausgestiegen sind, gibt es den Notdienst nur noch für unsere Landwirte.
Vetmeduni: Sie behandeln Groß- und Kleintiere. Konnten Sie sich nicht für ein Spezialgebiet entscheiden?
Dastig: Am Land stellt sich diese Frage gar nicht. Da werden Allrounder gebraucht. Bei mir ist es gewachsen. Momentan wechseln meine Kollegin und ich uns ab: je eine ist fast 24 Stunden für Großtiere erreichbar und fährt auf Außenvisite. Die andere macht die Kleintiere. Aber wir beherrschen beide beides. Jede hat zudem ihr Steckenpferd, wie ich die Assistenzhunde, und wenn es nötig ist, packen wir gemeinsam an.
Vetmeduni: Sie bilden nebenbei auch Assistenzhunde für Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder psychischen Erkrankungen aus. Wie kam es dazu?
Dastig: Ich bin selbst in meiner dritten Schwangerschaft zur Diabetikerin geworden und als Betroffene habe ich mich für Signalhunde interessiert. Meine Sprechstundenhilfe und ich haben dann gemeinsam die Ausbildung an der Akademie für angewandte Tierpsychologie und Tierverhaltenstraining (ATN) absolviert. Nebenbei bilden wir immer wieder einen individuellen Assistenzhund für ein Kind mit besonderen Bedürfnissen aus und stellen über Spenden-Aktionen das Geld dafür auf.
Vetmeduni: Worauf müssen denn Tierärzte und Tierärztinnen bei Assistenzhunden achten? Sie können ihre Aufgabe – als individuell ausgebildete Führhunde, Servicehunde oder Signalhunde – nur motiviert und bei guter Gesundheit ausüben.
Dastig: Es ist vor allem wichtig, sie nicht nur als Arbeitstier zu sehen. Sie gehören zur Familie, sind frei erzogen und sehr individuell, weil sie ja auf verschiedene Situationen reagieren müssen. Man muss den Besitzer:innen und den Veterinär:innen klarmachen, dass der Spaß bei der Arbeit wichtig ist, es neben den „Dienstzeiten“ aber auch Spiel- und Ruhezeiten braucht.
Vetmeduni: Geht es viel um Prävention?
Dastig: In der Beratung ist es sinnvoll die Besitzer:innen regelmäßig zur Vorsorge einzuladen. Wir sehen nach, ob alle Impfungen gegeben wurden. Aber auch beim Hundefriseur sehen wir ganz gut, in welchem Zustand das Tier ist. Wie auch bei Therapiehunden müssen regelmäßig Blut- und Kotproben abgegeben werden. Die Prüf- und Koordinierungsstelle für Assistenzhunde bzw. Therapiebegleithunde des Messerli-Forschungsinstituts prüft regelmäßig, ob die Tiere noch einsatzfähig sind. Assistenzhunde unterliegen in allen Phasen - ab der Auswahl, während der Ausbildung, in der Betreuung und bis hin zur Nachschulung strengen Qualitätskriterien, die von der Prüf- und Koordinierungsstelle kontrolliert werden.
Vetmeduni: Wie viele Hunde haben Sie bereits ausgebildet und wie lange dauert das?
Dastig: Wir sind jetzt beim vierten Hund und es dauert etwa zwei Jahre, bis er in die Familie gehen kann. Die Welpen kommen von heimischen Züchter:innen. Im ersten Jahr ist der Hund bei uns in den Familien mit Kindern und hält regelmäßig Kontakt zur künftigen Familie. Wir schulen den Hund und die Klient:innen im Umgang mit dem Hund. Wir lernen beide kennen. Es findet ein langsamer Übergang statt. Wenn der Hund in der Familie untergebracht ist, kommen wir dorthin und begleiten dann das Mensch-Hund Team zur Prüfung.
Vetmeduni: Wie kommen die individuellen Bedürfnisse der Klient:innen und die geeigneten Hunde zusammen? Gibt es bestimmte Rassen für bestimmte Aufgaben?
Dastig: Wir suchen den richtigen Hund mit passender Größe, Körperbau und dem geeigneten Charakter. Diabetiker:innen brauchen eher sportliche Tiere, für ADHS oder Rollstuhlnutzer:innen bieten sich ruhige Tiere an, bei Depressionen eher lustige. Ein Hund muss seine Aufgabe leicht schaffen können. Etwa Dinge aufheben oder besonders gut riechen können. Es gibt Wesenstests und Gesundheitschecks, aber dennoch muss es nicht immer klappen, dann wird es „nur“ ein Familienbegleithund. Oder er bleibt bei uns.
Vetmeduni: Wie sieht ein gewöhnlicher Arbeitstag bei Ihnen aus? Oder gibt es genau den gar nicht?
Dastig: Wenn man Tierärztin wird, muss man mit Flexibilität umgehen können. Man kann schon planen, aber es passieren unvorhergesehene Dinge, weshalb das Arbeitsende nie planbar ist.
Vetmeduni: Wurden Sie als Frau in diesem Beruf immer akzeptiert, oder haben Sie als Tierärztin abweichende Erfahrungen gemacht?
Dastig: Seit ich mich selbständig gemacht habe nicht mehr. Die Kunden, die sich fürs TGZ entschieden, oder zu uns gewechselt haben, wissen, dass es bei uns nur Frauen gibt. Man kann als Frau in diesem Beruf alles machen, weil es Techniken gibt, die man erlernen kann. Was mir heute eher auffällt, ist die Vorstellung als Tierarzt oder Tierärztin nur hoch spezialisiert sowie ohne Wochenend- und Nachtdienste arbeiten zu wollen. Das ist für mich ein schiefes Berufsbild. Wir brauchen am Land Leute, die eine Katze im Notfall genauso versorgen können, wie einem Schwein eine Spritze geben. Nur so kann ein 24 Stunden Notdienst angeboten werden. Für alles andere gibt es Spezialkliniken.
Vetmeduni: Gab es für Sie Überraschungen zwischen Ausbildung und Praxis?
Dastig: Die Bürokratie ist mehr geworden. Als ich angefangen habe, gab es einen Bruchteil der Dokumentation und der gesetzlichen Vorschriften. Auch der buchhalterische Aufwand ist nicht ohne. Das Kaufmännische habe ich zum Glück zu Hause gelernt, das wurde an der Uni wenig behandelt.
Vetmeduni: Worin liegt für Sie der Reiz der Tätigkeit?
Dastig: Auch nach 20 Jahren habe ich jeden Tag neue Fälle und neue Menschen vor mir. In unserem Job wird es nie langweilig. Ich kann mich laufend weiterentwickeln. Die Assistenzhunde werden für mich auch in der Pension ein gutes Hobby sein: sinnvoll, in Kontakt mit Menschen und sportlich aktiv.
Vetmeduni: Zeigen Ihre drei Söhne bereits Interesse am Beruf?
Dastig: Sie waren immer dabei, sind die Flexibilität im Job gewöhnt und kennen meine Freude am Beruf. Meine Söhne können am Hof spielen und abwarten, wenn ich arbeite. Oder mitmachen, ein Neugeborenes trockenrubbeln, etwas halten. Als es einmal lange gedauert hat, ist ein Sohn im Hundebettchen eingeschlafen.
Vetmeduni: Danke für das Gespräch!
(Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.)
VETMED: Wussten Sie immer schon, dass Sie Tierärztin werden wollen?
Janina Janssen: Überhaupt nicht! Ich hatte als Kind alle möglichen Berufswünsche – Tierärztin war nicht dabei bis zum Abitur. Medizin hat mich interessiert, obwohl in meiner Familie niemand in dem Bereich arbeitet. Zunächst habe ich ein Praktikum in Humanpathologie gemacht, um zu sehen, ob das mein Magen verträgt. Nach einem weiteren Praktikum in der Kleintierklinik Trier in meiner Heimat wusste ich es. Da gab es einige Diplomates mit Spezialisierungen – das hat mich inspiriert. Dass ich Chirurgin werden will, habe ich während des Internships an der Vetmeduni herausgefunden, wo man durch die Abteilungen rotiert und den Arbeitsalltag der Spezialisten kennen lernt..
VETMED: Warum haben Sie sich zu einer Residency an der Vetmeduni entschlossen?
Janssen:: Ich habe nach meinem Abschluss ein Jahr in einer Kleintierklinik in Hollabrunn gearbeitet, als Jungtierärztin stationäre Patienten betreut und Notdienste gemacht und dort gemerkt, dass ich noch mehr will. Wir haben einfach herausragende Spezialistinnen und Spezialisten hier in Wien. Für die Residency muss man sich in vielen Schritten bewerben, da gibt es viel Konkurrenz. Von Anfang an durfte ich von arrivierten Fachleuten für Orthopädie und Weichteilchirurgie lernen, was im europäischen Vergleich
etwas ganz Besonderes ist. Manche Kliniken haben einen oder zwei Diplomates. Aber diese Vernetzung und Nähe, dass du gleich jemanden fragen kannst, wenn zur Chirurgie noch ein dermatologisches oder endokrinologisches Problem kommt, das gibt es nur an einer Universität. Auch die fächerübergreifenden „Rounds“, also Falldiskussionen, sind sehr hilfreich, um eine breit gefächerte Ausbildung zu bekommen.
VETMED: Wie sah der gewöhnliche Arbeitstag an der Vetmeduni bei Ihnen aus oder gab es den gar nicht?
Janssen: Man kennt den Tag ungefähr. Man weiß, ob man einen Weichteil- oder Orthopädie-Schwerpunkt hat. Auf einen Tag in der Ambulanz zum Abklären der Patienten folgt immer einer mit Operationen, um zu behandeln. Als Resident in chirurgischer Ausbildung bereiten wir uns gut auf geplante Operationen vor, lesen relevante Literatur, üben vorab die Zugänge. Aber wie bei jedem Tierarztjob weiß man nicht, was sonst hereinkommt: Notfälle aus der Nachtschicht, Nachsorge, Tiere auf der Intensivstation, die sich verschlechtern. Der Vorteil ist: Alles passiert mit Supervision.
VETMED: Sie haben das Training im Sommer 2022 abgeschlossen? Wie geht es jetzt weiter? Was sind Ihre Pläne?
Janssen: Den klinischen Teil der Residency habe ich im Sommer 2022 abgeschlossen. Zur Prüfung gehe ich kommendes Frühjahr und mit dieser europäisch anerkannten fachärztlichen Ausbildung kann man gut in der Privatwirtschaft an einer großen Klinik oder an Universitäten Fuß fassen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, kann ich mir gut vorstellen, wieder an die Uni zurückzukommen und mein Wissen weiterzugeben. Jetzt sammle ich erst einmal weiter viel Fallwissen.
VETMED: Sie haben die alte Kleintierklinik in der Ausbildung erlebt, den Probebetrieb im Neubau und jetzt den Vollbetrieb. Woran spürt man den neuen Spirit?
Janssen: Das ist ganz leicht gesagt: Alle Abteilungen greifen gut ineinander durch die räumliche und fachliche Nähe! Ich war zu Beginn Stationsärztin, als die Innere Medizin mit der Chirurgie vorübergehend zusammengelegt wurde. Da habe ich schon bemerkt, wie sich die Zusammenarbeit durch kurze Wege verbessert – man kann sich über Fälle schnell mal austauschen. Die Anmutung ist wie in einer Humanklinik, das ganze Setting und die hochwertige, moderne Ausstattung machen die Arbeit zum Vergnügen. Man spürt es auch am
guten Umgang miteinander. Alle geben sich Mühe, weil man ja aufeinander angewiesen ist und gegenseitig immer wieder Fälle einschieben muss.
VETMED: Hatten die Menschen, die hier arbeiten, Mitspracherecht?
Janssen: Das wurde ganz intensiv ab der Grundrissplanung gemacht – mit Working Groups aus Abgesandten jeder Abteilung. Im neuen Gebäude wurden im Probebetrieb Abläufe optimiert.
VETMED: Haben Sie selbst Hund oder Katze?
Janssen: Ich habe eine Katze. Ganz klassisch ist mir mal eine Patientin ohne Zuhause geblieben.
VETMED: Wie kommen Sie mit den Tierbesitzer:innen zurecht?
Janssen: Die Besitzer:innen sind meist sehr gut informiert und nehmen wahr, dass der Patient bei uns im Mittelpunkt steht. Durch die neuen Räume ist der Umgang deutlich persönlicher als früher. Als Tierärztin am Beginn der Karriere muss man aus vielen Gesprächen lernen: Vertrauen aufbauen, selbstbewusstes Auftreten und vermitteln, dass der kleine Liebling in guten Händen ist. Aber auch mögliche Komplikationen nicht zu verharmlosen. Man muss Verständnis für die Situation der Leute haben. Sie wollen gehört werden und dass ihre Sorgen und Ängste ernst genommen werden. Im Hinblick darauf ist die Ausbildung heute noch besser geworden. Jetzt haben die Studierenden Trainings mit Schauspieler:innen, um die Kommunikation mit Tieren und Tierbesitzer:innen zu üben.
VETMED: Worin liegt für Sie der Reiz der Kleintierchirurgie?
Janssen: Man hat einerseits konkret standardisierte Abläufe für die Diagnose und andererseits ist jeder Patient anders. Ich mag es, dass man bei der Chirurgie schnell einen Effekt sieht, wenn es den Tieren besser geht. Und ich mag die Handarbeit daran. Das Geschick der Hände, wenn es ordentlich gemacht wurde, bestimmt den Erfolg mit. Ich habe als Jugendliche viel Handarbeiten gemacht: häkeln, stricken, mit der Hand nähen, Perlentiere, Schmuck. Auch da habe ich mich daran erfreut, wenn das Endergebnis gut geworden ist.
VETMED: Welche Erwartungen hatten Sie an den Beruf und was hat sich in der Realität gezeigt?
Janssen:In der Ausbildung wurde damals eher schwarzgemalt: ein schlecht bezahlter, stressiger Job, für den man sein Leben aufgibt. Wenn man in der Arbeit viel erreichen will, muss man viel reinstecken, ja. Aber für Menschen, denen Work-Life Balance wichtig ist, gibt es mittlerweile auch Arbeitsplätze mit ganz normalen Zeiten und die Entlohnung wird immer besser. Unsere Ausbildung ist so breit gefächert, dass es für jeden Charakter einen passenden Job gibt.
VETMED: Danke für das Gespräch!
(Das Interview hat Astrid Kuffner für VETMED Magazin geführt.)
VETMED: Wussten Sie immer schon, dass Sie Tierärztin werden wollen?
Judith Piegger: Seit ich vier oder fünf Jahre alt war, war das mein Berufswunsch. Ich bin auf einem Bauernhof mit Milchkühen aufgewachsen. Wenn der Tierarzt kam, war das immer ein Highlight für mich. Das Ineinandergreifen von Landwirtschaft und Medizin fasziniert mich bis heute.
VETMED: Sie arbeiten seit Oktober 2016 als selbstständige Großtierpraktikerin im Bezirk Innsbruck Land. Wie sieht ein gewöhnlicher Arbeitstag bei Ihnen aus oder gibt es genau den gar nicht?
Piegger: Jeder Tag ist unterschiedlich, spontane Einsätze sind in der Nutztierpraxis gang und gäbe. Genau das mag ich daran. An meinen Praxistagen starte ich mit den Visiten um halb sieben Uhr morgens und fahre bis Mittag. Um 15 Uhr beginnt die Nachmittagsrunde, bis wie lange es halt geht, meist 20 oder 21 Uhr. Im Winter dauern beide Runden meist länger, weil da die meisten Kalbungen sind und die Anfahrt schwieriger ist. Der Sommer ist meist ruhiger und da springe ich dann gerne für Kollegen ein. Seit einem Jahr bin ich Mutter und fahre daher nur noch drei Tage die Woche und jedes dritte Wochenende. Sonst vertritt mich mein benachbarter Kollege.
VETMED: Haben Sie ein Spezialgebiet?
Piegger: In der Fahrpraxis mache ich alles. Am liebsten mag ich Geburten und Operationen. Dafür habe ich alles in meinem Auto. Ein VW Caddy mit Allrad und Zimmermann-Apotheke samt Kühlung, Besamungskübel und mobilem Ultraschall.
VETMED: Sie waren davor in einer Tierklinik in Tirol angestellt. Was hat Sie dazu bewogen sich selbständig zu machen?
Piegger: Ich war schon immer der Typ, der selbst eine Praxis aufbauen möchte. Das habe ich auch während der Anstellung gespürt. Aber ich konnte in der Klinik auch viel lernen und mir erste Kontakte zu Betrieben aufbauen. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich bin eben gerne meine eigene Chefin.
VETMED: Hat Sie die Ausbildung gut auf alle Aspekte des Arbeitsalltags vorbereitet?
Piegger: Das Studium hat mich gut vorbereitet, am meisten natürlich die praktischen Übungen und Praktika. Wer an einem Fachgebiet interessiert ist, sollte sich auf diese Art gut darin umschauen und mitfahren. Ich bin im bäuerlichen Umfeld aufgewachsen und wusste daher, wie die Kund:innen ticken. Ich bekomme selbst viele Anfragen von Studierenden, die mich begleiten wollen. Ich fürchte, wenn ich da einmal zusage, habe ich 365 Tage jemanden im Auto sitzen. Damit warte ich lieber noch etwas. Mich hat mein Nachbartierarzt und Kollege viel mitgenommen. Ich will damit sagen: Vernetzung ist wichtiger, als Konkurrenzdenken.
VETMED: Was war die größte Überraschung in der Praxis?
Piegger: In der Zeit als angestellte Tierärztin hatte ich auch manchmal das Kleintier-Nottelefon und habe mich sehr oft gewundert, mit welchen Problemen die Kleintierkunden mitten in der Nacht den Tierarzt kontaktieren, meistens waren es keine Notfälle, sondern Erkrankungen, die schon seit Wochen bestanden und auch während der Ordinationszeiten behandelt hätten werden können.
VETMED: Ihr Kollege mit der Kleintierpraxis im Ort hat eine Webseite. Brauchen Sie das nicht?
Piegger: In der Nutztierpraxis in Tirol gibt es keine Sprengel mehr. Sehr viel läuft über Mundpropaganda. Ich hatte in der Selbstständigkeit rasch genug zu tun, war ausgelastet und möchte die Betriebe gut betreuen. Der Kundenkreis ist ja recht überschaubar im Vergleich zum Kleintierbereich, also brauche ich keine Webseite, um neue Kund*innen anzusprechen.
VETMED: Welche Erwartungen haben Sie an den Beruf gehabt und wie hat sich im Vergleich dazu die Realität entpuppt?
Piegger: Es ist ein schon ein bisschen anders, als ich das als Fünfjährige erwartet habe. Da hatte ich anfangs sicher eine rosarote Brille auf. Die praktischen Probleme, die auf einen zukommen, sieht man nicht. Etwa wie man Beruf und Familie vereinbart, wenn das erste Kind kommt. Auch der Umgang mit den Tierbesitzer:innen. Im Umgang mit den Menschen gab es sicher mehr Überraschungen, als im Umgang mit den Tieren.
VETMED: Lassen sich denn Ihre Arbeitszeiten gut mit dem Familienleben vereinbaren?
Piegger: Ich habe Glück mit meiner Großfamilie: zwei Omas, ein Opa und mein Mann unterstützen mich. Sie sind ja in der Landwirtschaft und daher viel Zuhause. Wie ich es jetzt eingerichtet habe, ist es für mich ideal. Das kann ich gut schaffen.
VETMED: Immer mehr Frauen arbeiten als Tierärztinnen. Wurden Sie stets einfach so in diesem Berufsbild akzeptiert?
Piegger: Manche waren Frauen in der Nutztierpraxis noch nicht so gewöhnt. Bei meiner ersten Geburt kam die Bäuerin aus dem Haus und hat mich gefragt, wo mein Chef ist. Mittlerweile überwiegt das positive Feedback. Für die Jüngeren ist es schon ein vertrauterer Anblick. Man muss halt beim ersten Mal bei jedem Kunden beweisen, dass man es auch kann. Dass ich z.B. auch eine Gebärmutterverdrehung mit geeigneten Hilfsmitteln in den Griff kriege.
VETMED: Worin liegt für Sie der Reiz der Tätigkeit als Großtier-Landärztin?
Piegger: Es ist abwechslungsreich und ich kann mit wenigen Mitteln viel bewirken. Für eine Geburt brauche ich meist nur zwei Hände und gesunden Menschenverstand. In der Kleintierpraxis braucht man viel mehr Hilfsmittel und ich schätze die Verbindung von Landwirtschaft und Medizin. Ich berate ja auch darüber, wie man mit Fütterung und Pflege, mit Prävention, den Bestand gesund erhält. Ich habe also stets ein gemeinsames Ziel mit den Landwirt:innen.
VETMED: Sie wohnen auf einem Bauernhof mit Milchwirtschaft im Nebenerwerb. Wie trennen Sie da Arbeit und Privatleben?
Piegger: Normal bin ich für Trennung der beiden Bereiche, aber in einer Landwirtschaft ist das unmöglich. Ich kenne es nicht anders. Manchmal genieße ich es die Kühe einfach nur zu melken, statt zu untersuchen. Die Tage ohne Rufbereitschaft sind mein Privatleben. Aber wenn eine Kuh bei uns etwas hat, rufe ich auch keinen Kollegen an.
VETMED: Die Vetmeduni begegnet dem Mangel an Tierärzt:innen am Land mit einer neuen Außenstelle in Tirol. Welche weiteren Ideen haben Sie, um den Nachwuchs zu begeistern?
Piegger: Die Außenstelle ist eine super Idee. Die Studierenden können dort früh in den Beruf hineinschnuppern. Ich fürchte aber, dass der Mangel eher ein gesellschaftliches Problem ist. Berufe mit Nacht- und Wochenend-Diensten sind generell nicht mehr so beliebt. Es gibt immer weniger Bereitschaft körperlich und mehr als gefordert zu arbeiten. Viel verdienen mit wenig Aufwand spielt es in dem Beruf nicht. Ich hätte es manchmal auch gerne bequemer und weniger dreckig und frage mich, was ich mir da ausgesucht habe…
VETMED: Zum Thema Leben am Land: Was ist ein Klischee und wie ist es wirklich?
Piegger: Das Klischee ist, dass alle im Dirndl herumrennen. Und in Wirklichkeit gibt es überall solche und solche Leute. Je höher oben, also in Höhenmetern, desto lockerer sind die Menschen übrigens.
VETMED: Danke für das Gespräch!
(Das Interview hat Astrid Kuffner für VETMED Magazin geführt.)